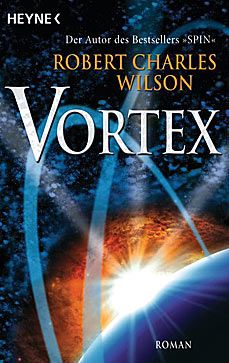
Robert Charles Wilson: "Vortex"
Broschiert, 399 Seiten, € 9,30, Heyne 2012 (Original: "Vortex", 2011)
Ein kurzer Moment der Nostalgie: Mit dem Vorgänger-Band zu "Vortex", "Axis", hat die SF-Rubrik auf derStandard.at seinerzeit begonnen; vier Jahre ist das mittlerweile her. Soweit es den kanadischen Star-Autor Robert Charles Wilson betrifft, begann die Saga 2005 mit einem Roman, der SF-Kritik wie LeserInnen gleichermaßen faszinierte: "Spin".
In "Spin" wird die Erde von außerirdischen Von-Neumann-Maschinen, den Hypothetischen, in einen Energieschirm gehüllt, der sich als Stasis-Feld entpuppt. In fünf Jahren subjektiver Zeit vergehen draußen im Universum vier Milliarden Jahre - als der Spin endet und sich der Schirm wieder öffnet, findet sich die Menschheit nicht nur in einer neuen Welt wieder. Die Hypothetischen haben ihr auch ein Tor in den Ozean gebaut, durch das man auf einen anderen Planeten reisen kann. Und von diesem auf den nächsten. Und so weiter. Was für eine coole Prämisse! "Vortex" ist nun gewissermaßen die eigentliche Fortsetzung dieses Paukenschlags. Das dazwischenliegende "Axis" war zwar ein schön zu lesender Roman, inhaltlich aber ein vergleichsweise nichtiges Zwischenspiel, ehe Wilson nun wieder die ganz großen Kaliber auspackt. Und wir erfahren endlich auch, wofür die Menschheit über all die Jahrmilliarden hinweg aufgespart wurde.
"Axis" hat indessen den Weg in Sachen Stimmung vorgegeben. Denn schon im zweiten Band der Trilogie war die Entdecker-Euphorie rund um die Weltentore spürbar abgeflaut. In "Vortex" sieht es nun sogar ganz danach aus, als hätten die Menschen das Schlimmste aus ihrer Chance gemacht: Die Klimaerwärmung verstärkt sich rapide, weil nun die fossilen Brennstoffe gleich zweier Planeten in den Himmel gefeuert werden. Zudem ist die US-amerikanische State Care, die sich in den Spin-Jahren all derer annahm, die durch Weltuntergangsängste und deren sozioökonomische Folgeerscheinungen entwurzelt wurden, zu einer Art Verwahrungs- und Wegsperrsystem verkommen. Man munkelt sogar über Pläne, die Internierten zu Zwangsarbeit heranzuziehen. Wenn eine der Romanhauptfiguren den über die Atmosphäre hinausragenden Bogen des Weltentors als ein Lächeln zwischen den Sternen sieht, dann ist dies wie ein letzter Nachklang einstiger Hoffnungen. Längst ist die große Desillusionierung eingekehrt.
Die Psychiaterin Sandra Cole erstellt für die State Care Gutachten darüber, was mit aufgegriffenen "Vagabunden" geschehen soll. Ihr aktueller Fall ist der junge Orrin Mather, der Zeuge verbrecherischer Aktivitäten geworden ist. Dass verschiedene Personengruppen größtes Interesse an ihm haben, könnte aber auch daran liegen, dass Orrin ein höchst eigenartiges Tagebuch führt. Darin scheint er Erlebnisse aus einer 10.000 Jahre entfernten Zukunft zu channeln - und die sieht noch viel schlimmer aus als die Gegenwart. Wilson hat sich neuere Hypothesen zum Massenaussterben an der Perm-Trias-Grenze vor 251 Millionen Jahren zum Vorbild genommen und zeichnet das Bild einer Erde mit gekippten Ozeanen und vergifteter Atmosphäre, auf der nur noch Mikroben existieren können. "Vortex" pendelt zwischen diesen beiden Zeitebenen in rascher Abfolge hin und her. Fast jedes Kapitel endet übrigens mit einem Cliffhanger - rührend, dass auch ein Visionär wie Wilson nicht vor solchen Standardgriffen in die Trickkiste gefeit ist.
In der Zukunftsebene begegnen wir einer Figur aus "Axis" wieder. Der Pilot Turk Findley kam am Ende des Romans auf Äquatoria, der neuen Nachbarwelt der Erde, ums Leben ... oder er wurde in virtueller Form von den Hypothetischen aufgenommen. Wie auch immer - knapp 10.000 Jahre später findet er sich an derselben Stelle in körperlicher Form wieder und wird von Pilgern der besonderen Art aufgegriffen. Vox ist ein Archipel gigantischer künstlicher Inseln - in ihrem Inneren arbeiten Maschinen, die eher Landschaften als Objekte sind, wie der staunende Turk feststellt. Bevölkert wird Vox von einer limbischen Demokratie aus emotional vernetzten Menschen. Oder genauer gesagt Gläubigen, denn sie reisen mit ihrem Archipel über die Meere des Weltenrings, um letztlich auf die verlassene Erde zu gelangen, wo sie mit den Hypothetischen zu verschmelzen hoffen: Man giert nach der "Entrückung".
Schon "Spin" enthielt eine stark spirituelle Komponente - man halte sich nur das Motiv von übernatürlichen Mächten vor Augen, die der Menschheit gleichsam eine Welt schenken ... aber in keinster Weise daran denken, ordnend in den Alltag einzugreifen und menschengemachte Probleme zu beheben. In "Vortex" ist die Spiritualität zu organisierter Religion heruntergekommen - mit allen Folgeerscheinungen. Bald zeigt sich, dass das auf den ersten Blick beeindruckende Vox sehr dunkle Schattenseiten hat und auch nicht die zuverlässigste Quelle historischen Wissens darstellt. Vielleicht wäre Turk doch besser auf die im Off bleibenden Feinde von Vox getroffen, die hier nur als skrupellose Angreifer in Erscheinung treten.
Wilson zieht für den Abschluss seiner Trilogie den wirklich GANZ großen Rahmen auf - das lässt an Stephen Baxter oder Olaf Stapledon denken ... insbesondere was den vergleichsweise kursorischen Schlussteil des Romans anbelangt. (Was darin geschildert wird, lässt sich vermutlich aber auch nicht anders darstellen.) Auch Wilsons eigener Roman "Darwinia" klingt hier noch einmal an. Einer der Gründe, die Wilson so beliebt gemacht haben, ist aber, dass er Macroscale-Ereignisse stets auf eine sehr menschliche Dimension herunterbricht. Wir fiebern mit Orrin und Sandra, Turk und Treya mit ... letztere eine Angehörige von Vox, der man eine Impersona aufgeprägt hat, eine aus alten Dokumenten rekonstruierte Pseudopersönlichkeit namens Allison Pearl. Die sollte Treya eigentlich nur das Kontextverständnis historischer Informationen erleichtern, entwickelt aber ein Eigenleben - und zwar eines, das stark von Treyas eigentlichem Charakter abweicht.
Während Treya/Allison zunehmend mit ihrer Identität beschäftigt ist und Turk erst mit der Nase darauf gestoßen werden muss, dass er eigentlich dasselbe tun sollte, zeichnet sich bei Orrin langsam ab, wo alle Handlungsfäden schließlich zusammenlaufen werden: In der Sehnsucht nach Vergebung und einer zweiten Chance. Stärker denn je verknüpft Wilson so Makrokosmos und Mensch, bis Orrins und Turks persönliche Schicksale ebenso große Bedeutung erlangen wie das der Erde oder gar des Universums selbst.
"Vortex" mag wie die ernüchternde Antwort auf "Spin" wirken. Aber auch wenn da, wo ein Sinn gesucht wurde, nur ein Zweck gefunden wird, lässt Wilson doch einen Platz für Hoffnung. Das gehört ebenso zu seinem Erfolgsrezept wie der klare Stil ("Vortex" liest sich trotz der Thematik federleicht) oder die oben beschriebene Verknüpfung kosmischer Ereignisse mit dem nur allzu Menschlichen. Und noch ein wichtiger Faktor kommt meiner Meinung nach dazu: Zeitlosigkeit. Mag Wilson auch neuere wissenschaftliche Konzepte - wie z. B. die Medea-Hypothese, das suizidale Gegenstück zur freundlichen Vorstellung einer Gaia - einbauen, so lebt sein Roman doch letztlich von einer schwindelerregend großen Idee. Und die hätte auch vor 30, 40, 50 Jahren schon jemand haben können - wie das bei der zugrundeliegenden großen Frage nach dem WARUM halt so ist. Aber ob sie ein anderer auch so fantastisch umgesetzt hätte, sei dahingestellt. Außer vielleicht Arthur C. Clarke in seiner besten Zeit. Dem kommt Robert Charles Wilson jedenfalls so nahe wie kein anderer Autor unserer Tage.
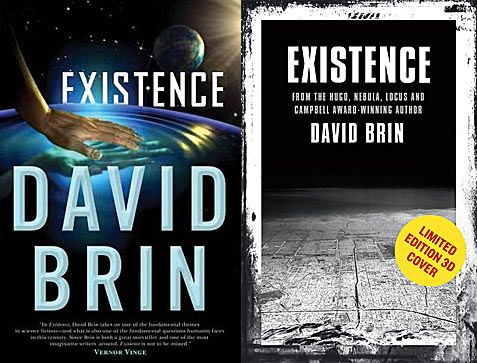
David Brin: "Existence"
Gebundene Ausgabe, Tor Books 2012 / Limitierte Paperback-Ausgabe, Orbit Books, jeweils 550 Seiten, 2012
Wenn ein SF-Superstar wie David Brin seinen ersten Roman seit zehn Jahren veröffentlicht, dann ist das per se schon ein Ereignis mit Donnerhall. Erst recht, wenn es sich wieder um einen Monumentalwälzer mit Ein-Wort-Titel handelt, der bescheidenen Welterklärungsanspruch suggeriert. Wir erinnern uns an "Earth" aus dem Jahre 1990. "Existence" ist darauf angelegt, "Earth" noch einmal zu toppen und sich zum größten 360-Grad-Panorama der Menschheit seit John Brunners "Stand on Zanzibar" aufzuschwingen. Was noch nicht heißen soll, dass das auch geglückt ist. Wenn am Anfang des Romans ein Astronaut darauf hinunterblickt, was sich down in that film of sea and clouds and shore tut, dann steht dies jedenfalls stellvertretend für die Vogelperspektive, aus der Brin den gesamten Roman angegangen ist. Das Ergebnis ist eine Truckladung voller brillanter Gedankengänge und dramaturgischer Defizite. Und natürlich Pflichtlektüre für jeden, der an Science Fiction und/oder Wissenschaft interessiert ist.
Gehen wir's mal vom Setting her an, denn Mitte des 21. Jahrhunderts hat Brins Menschheit schon einiges an einschneidenden Ereignissen hinter sich. Fluten, Verwüstung und Epidemien in Folge des Klimawandels. Eine Serie schmutziger Nuklearanschläge auf Städte, insbesondere in den mittlerweile balkanisierten USA. Den Big Deal, eine Neuorganisation der Weltgesellschaft in zehn voneinander möglichst getrennte Estates, angefangen bei der Sphäre der Superreichen über die geschwächten Staatsregierungen und die Wirtschaft bis zur zehn Milliarden Angehörige umfassenden Masse von Otto Normalverbraucher. Und eine fortgeschrittene Informationstechnologie, die die ersten Künstlichen Intelligenzen und neue Phänomene wie Smart-Mobs (Ad-hoc-Zusammenschlüsse von Menschen, die gemeinsam ein Thema ergründen), aber keine Privatsphäre mehr kennt. Der städtische Alltag lässt sich durch hunderte verschiedene Schichten von virtuellen Overlays betrachten - und der ohnehin wortspielverliebte Brin ("Mickey Mao") hat Gelegenheit, am laufenden Meter Neologismen auszuwerfen: aixperts, aiconomy, vaura, virld, usw. usf. Glücklicherweise erschließen sich die allesamt unmittelbar aus dem Kontext. So surft man - quasi wie auf einem skutr - an und für sich erstaunlich leicht durch diese pralle neue Welt.
... die, wenn man's ganz genau nimmt, nur eine Fortschreibung unserer Gegenwart ist, eskaliert bis zu einem Grad, ab dem etwas grundlegend Anderes kommen muss. Durch sämtliche Subplots des Romans zieht sich die Gewissheit, dass entweder ein fundamentaler Wandel bevorsteht - oder das Ende. Die Kernfrage des Romans lautet also: Wohin will die Menschheit? Eine der im Roman agierenden Interessengruppen, das Renunciation Movement um einen pseudoindianischen Propheten, propagiert die Abkehr vom hochtechnologischen Weg ... und von der Demokratie als nicht-nachhaltiger Organisationsform gleich dazu. Brins Antwort sieht naturgemäß anders aus, ganz wie man es von einem Wissenschafter und SF-Autor erwarten darf.
Soweit die Ausgangslage. Und nun schlägt in diesen ohnehin schon aufgewühlten globalen Teich fast wortwörtlich zu nehmen ein Stein ein und schlägt Wellen. Ein kristalliner Brocken nämlich, der die virtuellen Kopien diverser Außerirdischer enthält (und wie in Brins populären "Uplift"-Romanen fühlt man sich dabei ein bisschen an Brehms Tierleben erinnert). Die überbrachte Botschaft der Aliens gefällt allerdings niemandem, denn sie kündet vom unvermeidlichen Ende nicht nur der Menschheit, sondern jeder technologischen Zivilisation. Bis andere Kristalle auftauchen und den ersten einen Lügner schimpfen.
Illustriert wird das Giga-Szenario anhand einiger Hauptpersonen (mit Vorbehalt): Gerald Livingstone, ein Astronaut und Weltraummüllsammler, der den ersten Kristall zur Erde bringt. Peng Xiao Bin, ein armer Schlucker, der davon lebt, was er aus den überfluteten Teilen Shanghais birgt, und in den Fokus konkurrierender Gruppierungen gerät, als er einen weiteren Kristall findet. Hamish Brookeman, ein cross-medialer Starautor von alarmistischen Wissenschaftsthrillern, der für das Renunciation Movement arbeitet. Die schwerreiche Lacey Sander, die ein Observatorium betreibt, und ihr verwöhnter Sohn Hacker, der nach einem missglückten Orbitaltrip im Ozean landet und dabei auf eine Gruppe ungewöhnlich intelligenter Delfine stößt (hier setzt Brin einen netten Verweis auf seine "Uplift"-Romane). Und die Journalistin Tor Povlov, die bei einem Terroranschlag verstümmelt wird und fortan mit künstlichen Sinnen und ausgelagerten Bewusstseinsteilen als eine der ersten transhumanen Personen weiterlebt.
Doch geht bei Brin Prozess vor ProtagonistInnen. So wird das Wiedersehen von Hacker und Lacey, das eigentlich ein emotionaler Höhepunkt sein müsste, lediglich per Nachsatz kurz erwähnt, Hacker verschwindet daraufhin ganz aus der Handlung. Und das ist nur ein Vorbote: Vor dem letzten Viertel des Romans erfolgt ein Zeitsprung, bei dem fast alle bisherigen Hauptfiguren verloren gehen. Mit Müh und Not kann man sich aus einigen Nebensätzen rekonstruieren, was aus ihnen geworden ist. Auch der Ausgang von über hunderte Seiten hinweg aufgebauten Subplots wie dem Putsch der Superreichen oder der Jagd auf eine Frau, die ein Baby mit rekonstruierter Neandertaler-DNA austrägt, wurde mittlerweile entschieden, ohne dass wir dabei sein hätten dürfen. Das ist ein echtes Unding. Selbst wenn die beiden Schlussteile für sich wieder sehr interessant sind, fühlt man sich da einfach betrogen.
Brins Stars sind eben nicht die Menschen, sondern die Konzepte, über die sie in Diskussionen, inneren Monologen und einer Vielzahl den Haupttext begleitender Dokumente aus fiktiven Quellen (darunter Pandora's Cornucopia, ein Füllhorn möglicher Weltuntergangsszenarien) philosophieren; David Brin hat seine Website übrigens explizit zur Plattform für weiterführende Diskussionen gemacht. Und die Namen der Stars, um nur einige zu nennen, lauten: Medea-Hypothese (siehe Robert Charles Wilsons "Vortex"). Das Fermi-Paradoxon und die Suche nach dem "Big Filter", der die Entstehung interstellar kommunizierender Zivilisationen verhindert. Positive Sum Games und Steven Pinkers jüngst veröffentlichter Befund in "The Better Angels of Our Nature", wonach das Ausmaß der weltweiten Gewalt trotz gegenteilig erscheinender Berichterstattung konstant am Sinken sei. Und John von Neumanns Konzept von selbstreplizierenden Weltraumsonden, das hier in eine fiese virale Richtung weitergedacht wird.
... nicht zu vergessen originelle Gedankenspiele, die zumindest zum Teil ihren Reiz haben. So wird Autismus hier als alternativer Weg der menschlichen Evolution gezeichnet. Und - das hat wirklich was für sich - die selbstgerechten Tiraden von Demagogen werden als Fall für die Medizin erkannt: Als Abhängigkeit vom Rausch des eigenen Hasses - analog zu Menschen, die der Spielsucht verfallen sind. Und eine Idee, die Brin bereits in "Earth" ausgesprochen hatte, ist in ihrer Logik so verblüffend (und hätte in einer besseren Welt das Potenzial zur Versöhnung feindlicher Lager), dass sie hier zu Recht noch einmal wiederkehrt. Preisfrage: Was war der ursprüngliche Auftrag des christlichen Gottes an den Menschen? Was also sollten wir eigentlich tun, wenn sich nicht seit dem Sündenfall alles nur mehr um "Schadensbegrenzung" gedreht hätte? Die Antwort gibt Genesis 2.19: "Und Gott der Herr machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte; denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen." Mit anderen Worten: Wissenschaftliche Erschließung der Welt.
Eine alte Faustregel der Phantastik besagt, dass unter ihren drei großen Kindern die Science Fiction den Kopf anspricht, die Fantasy das Herz und der Horror die Eingeweide. In Sachen SF ist "Existence" eine 550-seitige Beweisführung.
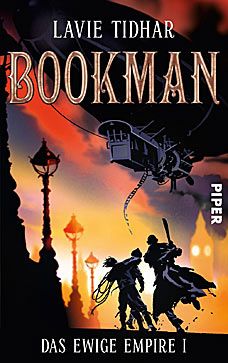
Lavie Tidhar: "Bookman"
Kartoniert, 423 Seiten, € 17,50, Piper 2012 (Original: "The Bookman", 2010)
Irgendwie kommt man sich erbärmlich vor, wenn man genau die Passage eines Buchs zitiert, die alle zitieren und die sogar im Klappentext angeführt wird. Aber was soll's, es ist nun mal die entscheidende: "Ach, Orphan, wir leben in einer Zeit der Mythen. Sie sind wie seidene Fäden aus der Vergangenheit in die Gegenwart gewoben, wie ein Drahtgeflecht aus der Zukunft, und bilden ein zusammenhängendes Muster, eine großangelegte Konstruktion mit sich wiederholenden Motiven." Der, der dem jungen Dichter Orphan im viktorianischen London diesen Vortrag hält, trägt selbst einen Namen mit mythologischem Gewicht: Gilgamesch. Und er ist nur eine von unzähligen Figuren aus der Literaturgeschichte, die den Eindruck erwecken, als würden in der Welt von "Bookman" Realität und Fiktion untrennbar miteinander verschmelzen.
Eine kleine Auswahl: Arthur Conan Dolye hat Professor Moriarty und Irene Adler beigesteuert, die hier als Premierminister bzw. Polizistin auftreten. Jules Verne geht zusammen mit seiner Schöpfung Kapitän Nemo auf große Fahrt, und auf derselben Realitätsebene findet man auch Charaktere aus Romanen von H. G. Wells oder Alexandre Dumas wieder. Ganz zu schweigen von den aberdutzenden Mikro-Verweisen, die der Autor überall da ausstreut, wo größere Mengen an Büchern versammelt sind und beim Titel genannt werden wollen. Da kann man dann auch schon mal auf Frank Herberts Prinzessin Irulan als Autorin stoßen; ohne größere Bedeutung, just for the fun of it. Eine ganz besondere Rolle spielt hingegen William Shakespeares "Sturm", denn Calibans Insel ist in der Romanwelt keine dichterische Schöpfung, sondern Wirklichkeit. Und bevölkert von einer Kolonie intelligenter Reptilien, die nach ihrer Entdeckung die Macht über Großbritannien an sich gerissen haben und seit Jahrhunderten die Herrscherdynastie stellen. Auch Königin Viktoria trägt also Schuppen und Schwanz.
Hauptfigur Orphan - der symbolische Name wird noch von Bedeutung sein - ist ein hoffnungsvoller Jungautor und arbeitet in einem Buchladen (soll keiner sagen, Lavie Tidhar würde ein Leitmotiv nicht konsequent durchziehen ...). Vom berüchtigten Terroristen Bookman hat er bislang nur gehört. Tatsächlich ist der erste im Buch beschriebene "Terroranschlag" einer von der dadaistischen Art und geht nicht auf das Konto des Bookman: Clowns plärren Oscar Wilde Limericks ins Ohr und verhindern so, dass er "The Importance of Being Earnest" schreibt. Für die Literaturgeschichte ein bedauerlicher Verlust, aber kein Vergleich mit den Taten des Bookman selbst. Denn die kosten Leben - schließlich auch das von Orphans geliebter Lucy. Eine Tragödie, die ihn dazu verdonnert, seinerseits ein mythologisches Motiv zu wiederholen: Wie sein Beinahe-Namensvetter Orpheus steigt er in die Unterwelt hinab, um Lucy zurückzuholen.
Dass dieses Unterfangen zumindest eine kleine Aussicht auf Erfolg hat, ist der grellen Steampunk-Welt zu verdanken, die Lavie Tidhar für "Bookman" entworfen hat. Eine Mars-Sonde findet darin ebenso Platz wie eine Reihe künstlicher Intelligenzformen (Automata und Simulacra), die sich ihrer selbst bewusst sind und nach Unabhängigkeit streben - oder eben verschiedene Wege, von den Toten zurückzukehren. Frankenstein und transhumane Science Fiction finden sich hier in trautem Einklang wieder. Wer Lavie Tidhar kennt, weiß, dass sich der binnen kurzer Zeit zum Star gewordene israelische Autor auf kein Genre festnageln lässt. In seinen Kurzgeschichten und Novellen deckte er von Science Fiction und Fantasy ("Cloud Permutations" bzw. "Gorel and the Pot-bellied God") über Alternative History ("Osama") bis zu völlig Bizarrem ("The Tel Aviv Dossier") so ziemlich jedes Subgenre der Phantastik ab. In seiner bislang einzigen Romanserie ("Bookman" plus bislang zwei Fortsetzungen) wirft er das alles in einen großen Topf. Befeuert wird die Mischung durch soziale Revolutionen und politische Ränkespiele und als Gewürz dient - thematisch erwartbares - Namedropping von Karl Marx über Ada Lovelace bis zum Schachtürken. Das kennt man schon aus William Gibsons & Bruce Sterlings "Differenzmaschine" - "Bookman" ist quasi die Pepsi-Version davon.
Ungewohnt, aber durchaus erfrischend ist der Umstand, dass es sich bei Orphan um eine eher antriebslose Hauptfigur zu handeln scheint. Er ist schnell von etwas fasziniert und wechselt wie ein junger Hund von einer Duftspur zur anderen, verfolgt aber keine davon konsequent. Die immer größer werdende Dimension der politischen Ereignisse, in die er hineingerät, ist ihm im Grunde egal und auf seine Abenteuer muss er - mehrfach - buchstäblich entführt werden. Bezeichnenderweise reagiert er auf ein solches Kidnapping einmal so: Es gibt keine andere Möglichkeit, dachte er - und diese Überlegung machte ihn auf einmal glücklich. Keine Verantwortung mehr zu haben, die Angelegenheiten der großen Welt, die ihn nichts angingen, zu vergessen ... Zu seiner Ehrenrettung sei aber gesagt, dass er ein Ziel immer vor Augen hat, und das auch noch zu einem Zeitpunkt, an dem der Leser angesichts des immer unübersichtlicher werdenden Handlungsstrudels längst nicht mehr daran denkt: Lucy wiederzufinden.
"Bookman" ist sicher nicht jedermanns Sache, sei es wegen seiner teils fast schon comichaften Züge (Tidhar ist ein ausgemachter Fan der Pulp-Kultur), sei es wegen des Übermaßes an literarischen Anspielungen, von denen es zugegebenermaßen ein paar weniger auch getan hätten. Aber all das Blendwerk sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich um einen - auf äußerst verspielte Weise - sehr intelligenten Roman handelt. Und damit auch um einen sehr unterhaltsamen.

Michael K. Iwoleit: "Die letzten Tage der Ewigkeit"
Broschiert, 256 Seiten, € 13,40, Wurdack 2012
Unter den Faktoren, die einen auf ein Buch aufmerksam machen können, spielt der Verlag für mich normalerweise eine eher untergeordnete Rolle. Allerdings zeichnen sich im Verlauf der Jahre doch einige Muster ab, und eines davon lautet: Bei Wurdack findet man exzellente deutschsprachige Science Fiction. Zu den AutorInnen, die ich über den kleinen Verlag aus der Oberpfalz kennengelernt habe, zählen unter anderem Heidrun Jänchen, Karsten Kruschel, Frank Hebben und Karla Schmidt - jede/r davon hat mir Leseerlebnisse weit über dem Durchschnitt beschert. Da gesellt sich nun Michael K. Iwoleit hinzu. Nicht dass der Autor, Übersetzer, Herausgeber und Kritiker von SF neu im Geschäft wäre ... aber ich bin's eben. Vier Jahre Rundschau machen noch keinen Sommer. Nach der Lektüre der in "Die letzten Tage der Ewigkeit" versammelten zwei Novellen und vier Kurzgeschichten ist jedenfalls der Appetit auf Iwoleits frühere Werke geweckt. Nicht zuletzt, weil diese Erzählungen etwas einbringen, vor dem deutschsprachige AutorInnen mehrheitlich zurückzuschrecken scheinen: einen Touch Hard-SF.
Am drastischsten zeigt sich dies in der ältesten der hier präsentierten Geschichten, "Wachablösung" aus dem Jahr 1995. Die Erzählung beginnt mit der minutiösen Schilderung einer posthumanen Geburt. In sachlich-kalter Weise läuft vor uns der Prozess ab, in dem ein namenloses Individuum in eine globale Vernetzung hineingeboren wird, um schließlich auf einen anderen Planeten geschickt zu werden. Dort beobachtet es die Ablöse einer kristallinen durch eine organische Evolution, während in ihm selbst der umgekehrte Prozess abläuft: Schritt um Schritt entwickelt sich sein künstlicher Aktionskörper weiter, bis sein unnütz gewordener biologischer Restanteil ausgeschieden wird wie Kot. Vier Jahre später schrieb Iwoleit "Der Schattenmann" - nebenbei ein Paradebeispiel dafür, wie gut es ist, wenn eine Kurzgeschichte nicht mit dem Ausrufezeichen einer Pointe, sondern mit einem gespannten Fragezeichen endet. Besagter Schattenmann überwacht bei öffentlichen Auftritten wohlhabender Personen die Datenflüsse in deren Umgebung - schließlich besteht in der Haifisch-Ökonomie seiner Ära jederzeit die Gefahr eines Mind-Hacks. Bei einem Attentat wird er so schwer verstümmelt, dass er eigentlich sterben müsste - doch auf irgendeine Weise krallen sich seine Überreste am Leben fest. Und entwickeln sich zu etwas Neuem.
Biotechnologische Elemente haben - ob beabsichtigt oder nicht - bei Iwoleit eine tendenziell schrecken- bis ekelerregende Komponente. Das gilt auch für die monströsen Hassler-Frogs in der Titelgeschichte "Die letzten Tage der Ewigkeit": Gigantische Zuchtkreaturen, die durch verwaiste Landstriche kriechen und sämtliche Biomasse in brauchbare Substanzen umwandeln. Doch konnte sich vor diesem Biopunk-Hintergrund wider Erwarten ein Stück alter Futurismus etablieren, also einer, in dem Mobilität statt Information im Fokus steht. Wir fühlten uns wie Angehörige eines neuen Volkes, das nur aus jungen, hoffnungsvollen Menschen bestand, denen chauvinistische Dünkel nichts bedeuteten, heißt es in "Die letzen Tage". Das klingt wie eine nostalgische Erinnerung an die Zeit, bevor die Science Fiction den Zynismus entdeckte - doch das persönliche Wettrennen um den Ruhm des ersten Überlichtflugs, ausgetragen zwischen einem Theoretiker und einem Tatmenschen, wird noch eine bittere Windung nehmen.
Iwoleits Interesse scheint eher der theoretischen als der praktischen Physik zu gelten (ein geostationärer Orbit über dem Kaspischen Meer?), aber dort lauern ja auch die Fragen, die die Existenz betreffen. Was in "Die letzten Tage" bereits anklang, wird in "Planck-Zeit" noch stärker herausgearbeitet. Rein theoretisch besteht ja die Möglichkeit, dass unser Universum in seiner jetzigen Form (inklusive unserer Erinnerungen an eine vermeintliche Vergangenheit) gerade erst dem berühmten Quantenschaum entsprungen ist. Was das für einen Unterschied macht? Nun ja, die Naturgesetze wären dann kein seit Jahrmilliarden eingespieltes Team ... vielleicht stellt sich ja heraus, dass sie langfristig gar nicht funktionieren. Wissenschaftsjournalist Konrad entdeckt in "Planck-Zeit" jedenfalls beunruhigende Anzeichen dafür, dass sich ursprünglich winzige Veränderungen allmählich auf immer höhere Ebenen erstrecken - am Ende könnte die komplette Auflösung der Realität stehen.
Bei längeren Erzählungen kommt die persönliche Entwicklung der ProtagonistInnen naturgemäß stärker ins Spiel als bei den kurzen. "Ich fürchte kein Unglück" dreht sich um einen Software-Entwickler, der wegen einer Affäre seine Karriere hinschmeißt, später aber zu den LightCubes genannten neuartigen Computern, die ihn berühmt gemacht haben, zurückkehrt, um mit ihnen nach möglichen Signalen in der kosmischen Hintergrundstrahlung zu forschen. Für mich die schwächste Geschichte in diesem Band, dafür aber direkt gefolgt von der besten. Und es ist doch immer wieder eine Freude, wenn man feststellen kann, dass die beste Geschichte zugleich die jüngste ist. "Zur Feier meines Todes", hier erstmals erschienen, führt uns anhand des Lebens einer Person - Gavril - das Entstehen und Voranschreiten einer posthumanen Zivilisation vor Augen.
Gavril scheidet freiwillig aus dem Leben - was wiederum einem jungen Ehepaar die behördliche Erlaubnis gibt, ein Kind zu zeugen. Auf der dazugehörigen Feier können die Gäste in Simulationen die wichtigsten Stationen von Gavrils Lebensweg nachempfinden. Dazu gehören sehr persönliche Momente wie die Trennung von seiner Frau, die eine künstliche Unsterblichkeit kategorisch von sich weist. Aber auch globale Wegmarken wie der Massenmord an normalsterblichen Menschen durch eine neu entstehende Schwarmintelligenz. Oder der Bau eines Mega-Damms in der Beringstraße, den die neuen Mächte in Asien und Ozeanien vorantreiben, ohne einen Deut darauf zu geben, dass ihren einstigen Kolonialherren in Europa und Nordamerika damit eine neue Eiszeit droht (schade nur, dass Iwoleit später nicht mehr darauf eingeht, wie all das weitergegangen ist). Gavril selbst spielt dabei eine ambivalente Rolle: Mal treibt er neue Entwicklungen voran, mal reagiert er auf die, die noch weiter vorangeschritten sind als er selbst, mit dem gleichen Entsetzen wie seine Frau einst auf ihn. Der glückliche Vater in spe, den Gavril auf seine Abschiedsparty eingeladen hat, betrachtet den einstigen Pionier insgeheim längst als Relikt.
Abschiede sind das Generalthema dieser beeindruckenden Erzählung. Und stets lässt das Neue das Alte gnadenlos hinter sich - symbolhaft dafür das Verfahren der Mnemotomie, mit dem man sich belastende Erinnerungen einfach entfernen lassen kann. Eine junge Frau auf Gavrils Party schließt aus ihrer Einladung, dass sie in irgendeiner Beziehung zum Gastgeber gestanden haben muss ... aber so genau wissen will sie's eigentlich lieber nicht. Und Gavril, der in seinen nun schon 250 Jahren von einem Lebensentwurf zum anderen gependelt ist, muss sich stellvertretend für alle die Frage stellen, ob es in dieser Welt der unbegrenzten transhumanen Möglichkeiten überhaupt noch Platz für das gibt, was wir unter einem Menschen verstehen. Die existenzielle Unsicherheit, die in "Die letzten Tage der Ewigkeit" und "Planck-Zeit" aus den Tiefen des Universums über uns hereinbricht, kommt nun aus uns selbst. Das ist State of the Art Science Fiction.
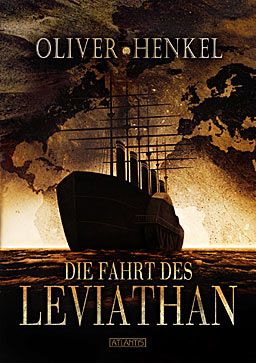
Oliver Henkel: "Die Fahrt des Leviathan"
Broschiert, 582 Seiten, € 15,40, Atlantis 2012
Für alle, die sich zwischen SF- und Fantasy-Blockbustern auch gerne mal einen Kostümfilm reinziehen (aber bitte eine Merchant/Ivory-Produktion!), kommt hier der richtige Stoff. Oliver Henkel, der in der Rundschau schon mit dem Alternativwelt-Szenario "Im Jahre Ragnarök" vertreten war, lässt in "Die Fahrt des Leviathan" ohnehin einen Hang zu szenischer Einführung erkennen: Wir "sehen" eine junge Frau im Wind an der Reling stehen ... und dann zack! wird eingezoomt und wir erfahren, um wen es sich handelt. Dieses Stilmittel wird über den gesamten Roman hinweg immer wieder angewandt. Es ist ein Roman, dessen Handlung sehr viel an Lebenskultur und gepflegter Konversation transportiert. Und was soll man sagen? Irgendwie trägt das eine Erzählung von solch beträchtlicher Länge viel besser, als wenn die knapp 600 engbedruckten Seiten ein einziges Action-Feuerwerk wären. Mich hat der "Leviathan" jedenfalls bärig unterhalten.
Dieser Tage ist es ja schon richtiggehend ungewöhnlich, wenn ein Alternativweltroman im 19. Jahrhundert (genauer gesagt in den Jahren 1862/63) angesiedelt und trotzdem kein Steampunk ist. Keine lochkartengesteuerten Mechagodzillas, kein Warp-Antrieb mit Propeller, keine übernatürlichen Mächte - nix davon. Exemplarisch eine Passage, in der eine der Hauptfiguren dem US-Präsidenten vorgestellt wird. An dieser Stelle scheint ein Knalleffekt fast unvermeidlich ... aber nein, der Präsident heißt Abraham Lincoln. Und er ist nicht mal ein Vampir. Bloß eine Augenklappe trägt er nach einem beinahe geglückten Attentat. Minimale Änderungen sind es, die Henkel an der Historie vorgenommen hat - mit einer einzigen Ausnahme. Und wie der buchstäbliche Schlussstrich am Ende des Romans zeigt, verändert selbst die den globalen Geschichtsverlauf weniger, als man denken würde: Preußen hat sich einst in den Wirren der Amerikanischen Revolution South Carolina gekrallt. Das ist nun die preußische Überseeprovinz Karolina, ihre Hauptstadt heißt Friedrichsburg statt Charleston und in der Bucht vor dem Hafen liegt statt dem berühmt-berüchtigten Fort Sumter die Bastion Derfflinger. Nicht der ruhigste Platz auf Erden, mitten im Krieg zwischen Union und Konföderierten. Aber vorerst wiegt sich das neutrale Karolina noch in Sicherheit.
Der Offizier Wilhelm Pfeyfer lebt in Friedrichsburg und ist ein echter Preuße: Pünktlich, pedantisch und pflichtbewusst - und das sind nur die P's. Und er ist das, was man heute einen Afroamerikaner nennen würde, was im Roman aber - dem damaligen Sprachgebrauch getreu - Neger heißt. Denn Preußisch-Karolina ist zwar ganz klar monokulturell, aber durch und durch multiethnisch: Europäischstämmige Bevölkerung und befreite SklavInnen mischen sich unterschiedslos mit amerikanischen UreinwohnerInnen ... da kann man schon mal einem Adalbert von Fliegender-Schwarzer-Adler begegnen. Klingt paradiesisch und ist auch einer der Gründe, warum Pfeyfer einem rosig verklärten Preußen-Bild anhängt. Anhand eines Offiziers, dem klargemacht wird, dass er als Jude keine Karrierechancen hat, zeigt Henkel aber früh, dass es im aufgeklärten Karolina sehr wohl auch Diskriminierung gibt. Im Laufe des Romans wird Pfeyfer die Sicht auf sein geliebtes Heimatland mehr und mehr überdenken müssen.
Andere sehen die politischen Verhältnisse ohnehin kritischer: Zum Beispiel die angehende Lehrerin Amalie von Rheine, die aus dem Mutterland als unbequem abgeschoben wurde. Oder Rebekka Heinrich, Direktorin einer Schule für höhere Töchter, die sich bei ihrer Kritik am Staat kein Blatt vor den Mund nimmt und Pfeyfer naturgemäß ein Dorn im Auge ist. "Die Fahrt des Leviathan" lebt von einem sehr großen Ensemble, wobei auch den Nebenfiguren - vom ehemaligen Sklaven bis zu hochrangigen Politikern - viel Erzählraum gewährt wird. Besonders zu erwähnen sind noch zwei: Zum einen der Unglücksrabe Alvin H. Healey, der eine kleine Handelsvertretung der Konföderation in Friedrichsburg übernimmt. Von Schwermut geplagt und unglücklich in Amalie verliebt, wird er bald im Zentrum einer gewaltigen politischen Intrige stehen (die mit dem Schlusstwist eine noch gewaltigere Dimension annimmt). Und alle Fäden des Netzes, in denen sich die ProtagonistInnen nach und nach verfangen, gehen auf einen einzigen Mann zurück, den zwielichtigen Krüger alias Kolowrath.
Henkel arbeitet mit einem ähnlich großen Ensemble wie zuvor David Brin in "Existence" - aber auf komplett andere Weise. Hier illustrieren die ProtagonistInnen nicht das größere Geschehen, hier lenken sie es. Wenn auch nicht immer beabsichtigt. Banale persönliche Motive - der Wunsch, der Herzensfrau ein teures Armband zu schenken, die Hoffnung, der Nachwelt etwas Bleibendes zu hinterlassen, die Bitte um einen kleinen Gefallen mit Hintergedanken oder einfach nur der Wunsch nach Rache - können ungeahnte Folgen zeigen. Es ist, als wäre ein gewaltiger Baum durchgesägt worden, und der kleinste Schubs kann nun darüber bestimmen, wohin er fällt. Etwas Großes ist in Bewegung geraten, und der Leviathan des Titels - eigentlich die "Great Eastern", das größte Schiff seiner Zeit - spielt dabei fast nur eine symbolische Rolle. Es erlangt auch erst in der zweiten Romanhälfte Bedeutung, wenn sich der einzige reißerische Subplot des Romans entfaltet. Der eigentliche Leviathan ist das Geflecht aus Krieg, Politik und Geheimdienstaktivitäten, das auf ein für (fast!) alle unabsehbares Ende zusteuert.
Bei den "Sissi"-Filmen der 50er Jahre hat man, wenn ich mich richtig erinnere, ironisch von der "Backhendl-Zeit" gesprochen: Einer so nie stattgefundenen und verklärten k. u. k.-Epoche. Henkel scheint über lange Zeit hinweg hart an der Grenze zu einem ähnlich geschönten Ambiente dahinzusurfen - allerdings geht ein Großteil davon auf Pfeyfers Konto, der Preußen durch die rosa Brille sieht. Parallel zu Pfeyfers Gesinnungswandel relativiert sich dieser Eindruck dann, bis wir schließlich der harten Realpolitik ins hässliche Gesicht glotzen. Anzumerken bleibt lediglich, dass wir uns zum allergrößten Teil in Kreisen des gehobenen Bürgertums aufhalten. Einen genaueren Blick auf das Leben in den ärmeren Schichten Karolinas erhalten wir nicht.
Doch das trübt den positiven Gesamteindruck des Romans nur geringfügig, ebenso wie diverse Zufälle im Timing, die Henkel wieder mal ein bisschen oft bemüht. "Die Fahrt des Leviathan" bietet eine gut ausgewogene Mischung aus Spannung, Humor, Tragik und Ernüchterung und ist überdies gespickt mit überraschenden Twists und historisch passenden Cameo-Auftritten. Wobei mein liebster anachronistisch ist und unter die Kategorie Schabernack fällt: Nämlich die geschickt getarnte Aufführung eines Louis de Funès-Films auf einer Friedrichsburger Theaterbühne. Es war sehr schön, es hat uns sehr gefreut.

Ian Whates: "Geisterjagd"
Broschiert, 448 Seiten, € 9,30, Heyne 2012 (Original: "The Noise Within", 2010)
"Dies ist 'The Noise Within', das Schiff aus Ihren schlimmsten Albträumen. Deaktivieren Sie bitte Ihre Triebwerke und bereiten Sie sich darauf vor, geentert zu werden, oder tragen Sie die Konsequenzen." Schön, wenn sich ein Piratenschiff so artig vorstellt - und es ist übrigens wirklich das Schiff selbst und nicht etwa irgendwelche zweibeinigen Insassen, denn über so etwas verfügt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Weswegen es seinen Jungfernraubzug auch mit den Worten abschließt: "Wir suchen nach Freiwilligen, die sich unserer Crew anschließen. Hat jemand Interesse?" Einer nimmt das Angebot tatsächlich an.
Was Kyle, der von seinem Job gelangweilte Sicherheitsoffizier eines Luxusliners, an Bord der zunächst noch menschenleeren und mit fremdartiger Technologie ergänzten "The Noise Within" erlebt, hätte gut und gerne alleine Stoff für einen Roman abgegeben. Ian Whates, ein britischer SF- und Fantasy-Autor, der noch relativ neu im Geschäft ist, hat allerdings anders entschieden; am Buchrücken steht nicht ohne Grund "Space Action". Der Roman beginnt mit einer mehrseitigen Egoshooter-Sequenz - etwas, an dem mein Desinteresse so monumental ist wie an der Formel 1 und alpinem Skilauf. Was natürlich persönliche Geschmackssache ist, aber nicht ohne Auswirkungen auf die Romanfiguren bleibt. Der Soldat bzw. Eye Gee Leyton, der diese Eröffnungspassage bestreitet und später auf die Spur des Piratenschiffs gesetzt wird, geht dazwischen noch auf diverse Action-Einsätze. Und jeder davon hätte genausogut von einer jeweils anderen Nebenfigur bestritten werden können, so gesichtslos bleibt Leyton ... etwas Schlimmeres kann man über einen Romanprotagonisten kaum sagen. Erst später gewinnt Leyton langsam an Konturen; aber vielleicht gewöhnt man sich auch nur an seinen Namen.
Interessanter ist da schon der wohlhabende Software-Entwickler Philip Kaufman, der das Familienunternehmen weiterführt, das der Menschheit den Überlichtantrieb geschenkt (beziehungsweise verkauft) hat. Bestürzt stellt er fest, dass das durch die Nachrichten geisternde Piratenschiff ein KI-gesteuerter Prototyp seines Unternehmens ist, der vor Jahren sang- und klanglos im Weltraum verschwand. Philip arbeitet an Mensch-KI-Interfaces und ist zudem ein heimlicher Cyber-Junkie. Er surft gerne durch die Datenströme seiner Nachbarn ... bis er an den Falschen gerät und dieser ein Kopfgeld auf ihn aussetzt. Philip flieht von seiner Heimatwelt und verfällt auf die Idee, auf eigene Faust nach der "The Noise Within" zu suchen. Klar, dass alle drei Protagonisten letztlich zusammentreffen werden - ihr Timing wird die Wahrscheinlichkeit dann allerdings etwas strapazieren.
"Geisterjagd" ist eine Mischung aus Old und New Space Opera. Zur alten gehören beliebte Fantasie-Technologien wie Traktorstrahlen, künstlich regulierbare Schwerkraft oder Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit - "new" ist vor allem die Betonung von Informationstechnologie. Irgendwie kann man sich von der aber kein rechtes Bild machen. Beispielhaft dafür eine Passage, in der sich Philip auf der Website eines Assassinen-Treffpunkts einloggt und dadurch in eine Computer Generated Reality eintaucht - trägt er jetzt ein Headset oder werden die Bilder, die seine Wohnung überlagern, von irgendwelchen Projektoren erzeugt? Der Schilderung lässt sich das nicht entnehmen - für einen Roman, der sich stark um das Thema Interfaces dreht, ist er erstaunlich vage, wenn's ans Eingemachte geht. Mal schwebt Philip durch abstrakte Datenströme, mal interagiert er via Avatar in einer echt wirkenden Simulation - während Leyton die Stimme seiner "intelligenten Waffe" im Kopf hört. Und ein Armband, das eine Mischung aus Facebook und irgendeinem Gadget vom Raumschiff Enterprise ist, taucht auch noch kurz auf. Ein dahintersteckendes Gesamtkonzept lässt sich nicht erkennen.
Ein weiteres Beispiel macht dies noch deutlicher: Mit dem Partial - einer digitalen Bewusstseinskopie - verfügt Whates' Romanwelt über ein Konzept, das ziemlich genau David Maruseks Proxy entspricht. Während die Proxys in Maruseks Erzählungen aber omnipräsenter Bestandteil der Gesellschaft sind und der Autor sich auch erkennbar Gedanken über Nutzen und Ausformungen einer solchen Technologie im Alltag gemacht hat, geistert durch Whates' Roman nur ein einziges Partial. Nämlich das von Philips Vater, der seinen Sohn als eine Art digitaler Quälgeist begleitet. Jedenfalls bis er im Speicher der "The Noise Within" festgesetzt wird und für längere Zeit aus der Handlung verschwindet: Ein Schicksal, das er mit diversen anderen Figuren und Gadgets teilt. Etwas bzw. jemand taucht auf, spielt eine mal mehr, mal weniger überzeugende Rolle, taucht ab und wartet dann darauf, dass der Autor sich wieder daran erinnert. Whates jongliert mit mehr Bällen, als er handhaben kann - da hilft ihm auch die künstliche Schwerkraft nichts.
Eine Anmerkung noch: Auch wenn für einen der Protagonisten ein Lebensabschnitt endet, ist "Geisterjagd" kein abgeschlossener Roman, er bricht einfach ab. Die Fortsetzung "The Noise Revealed" ist 2011 im Original erschienen, deutschsprachige LeserInnen werden sich noch etwas gedulden müssen. Wer Ian Whates' Version von "Space Action" lesen oder einem jüngeren Geschwister schenken will, sollte daher besser gleich auf Teil 2 warten.

Lucius Shepard: "The Dragon Griaule"
Gebundene Ausgabe, 431 Seiten, Subterranean Press 2012
Seit 1984 arbeitet der vielseitige US-amerikanische Autor Lucius Shepard an einem ziemlich ungewöhnlichen Werk. In den bislang sechs Erzählungen rund um den Drachen Griaule übertrug er nämlich ein typisches SF-Motiv, das BDO, auf die Fantasy. Wobei die Crux für alle Beteiligten ist, dass besagtes object zwar unleugbar big, aber vermutlich keineswegs dumb ist: Im Carbonates-Tal irgendwo im Süden der Welt liegt seit undenklicher Zeit der versteinerte Körper des Drachen Griaule; kilometerlang, hoch wie ein Hügel und bis auf den Kopf von Pflanzen überwuchert. Sein Herz schlägt nur einmal alle 1.000 Jahre, seit er von einem Zauberer mit einem Bann belegt wurde. Aber tot ist er noch nicht - und sein böser Wille sickert hinaus ins Tal und schließlich über die ganze Welt, um die Menschen zu Marionetten seiner gigantischen, undurchschaubaren Pläne zu machen.
... oder so wird es jedenfalls immer wieder behauptet. Doch sind BDOs nicht zuletzt ja auch stets Projektionsflächen für persönliche Wunschvorstellungen. Ist es wirklich Griaules Wille, der die ProtagonistInnen der sechs hier versammelten Erzählungen zu ihren Taten treibt ... oder sind sie für diese selbst verantwortlich? Nehmen wir die Geschichte "The Father of Stones". Darin übernimmt der Rechtsanwalt Korrogly die Verteidigung des Mörders Lemos, der behauptet, bei der Tat unter dem Einfluss Griaules gestanden zu haben. Das Opfer war der Anführer eines Kults, der dem untoten Ungetüm hätte gefährlich werden können. Doch ist die Sachlage wesentlich komplizierter, wie Korrogly im Zuge seiner Recherchen herausfindet. Und dabei seine Unschuld einbüßt.
Auch die junge Catherine, die in "The Scalehunter's Beautiful Daughter" nach einer Vergewaltigung ins Innere des Drachen flieht, glaubt dort den omnipräsenten Druck Griaules auf sich lasten zu fühlen. Ihre Zufluchtsstätte wird über Jahre hinweg zu einer Art neuem Zuhause. Und während sich Catherine den Kopf darüber zerbricht, welche Aufgabe der Drache für sie vorgesehen hat, nutzt Shepard die Geschichte vor allem, um das bizarre Ökosystem im Inneren Griaules zu beschreiben, wo Organe so groß sind wie Kavernen und Adern wie Tunnel. In "Liar's House" wiederum gerät Hota, ein Mann mit gewalttätiger Vergangenheit, in den Bann der Drachin Magali, die menschliche Gestalt angenommen hat. Doch sieht selbst sie sich nicht als selbstständig handelnde Akteurin, sondern ist überzeugt davon, gemeinsam mit Hota an den Fäden von Griaules Netz zu zappeln.
Begonnen hatte alles 1984 mit der Kurzgeschichte "The Man Who Painted the Dragon Griaule". Nach unzähligen vergeblichen Versuchen, das Riesenbiest endgültig sterben zu lassen, reist der junge Meric Cattanay mit einem besonders originellen Vorschlag an: Man solle den riesenhaften Drachenkörper doch bemalen - Griaule würde sich geehrt fühlen und gar nicht bemerken, dass ihn die giftigen Farben schleichend umbringen. Das klingt nach einer ziemlich windigen Idee, lässt aber eine immer größere und langsam alle Ressourcen verschlingende Infrastruktur rund um den Drachen entstehen, die die Projektbetreiber schließlich sogar in Kriege mit den Nachbarländern treibt. Stecken da etwa geheime Welteroberungspläne Griaules dahinter? Das kann man nur vermuten, denn bloß in einer einzigen Geschichte tritt die Titelfigur direkt in Erscheinung. In "The Taborin Scale" werden Menschen in ein zeitlich versetztes Taschenuniversum entführt, in dem ihnen ein junger Griaule begegnet. Ohne sich aber wirklich preiszugeben: Wer seinen Geist streift, fühlt einen Abgrund - der Wille des Drachen duldet keinen Widerstand, lässt sich aber auch nicht begreifen.
Die Erzählungen können die Form einer Liebesgeschichte, eines Gerichtssaaldramas oder auch eines Reports annehmen. Überhaupt greift Lucius Shepard gerne zu dem Stilmittel, seinen Geschichten im Spiegel diverser fiktiver Dokumente einen historisierenden Touch zu verleihen. Begonnen hatte Shepard einst im Cyberpunk, neben Werken der Phantastik schrieb er aber auch Reportagen aus der realen Welt. So war sein bislang letztes auf Deutsch erschienenes Werk "Hobo Nation", das sich um Obdachlose dreht, die auf Güterzügen durch die USA trampen. Dazwischen veröffentlichte er eine Reihe von Erzählungen, die dem Magic Realism zuzuordnen sind. Und der drückt auch den "Griaule"-Werken seinen Stempel auf. Zum einen spielt die Atmosphäre eine enorme Rolle, die ihrerseits von einer wunderbar eleganten Sprache transportiert wird. Zum anderen geht es um Ambivalenzen, um Doppel- und Mehrdeutigkeiten. Sei es das (tatsächliche oder eingebildete) Wirken Griaules, seien es andere Situationen, die mehr als eine Deutung zulassen. Vielleicht erlebt Hota am Ende von "Liar's House" tatsächlich den ersehnten Transzendenzmoment. Vielleicht stirbt er aber auch einfach nur am Galgen.
Zu jeder Geschichte gibt es am Ende des Buchs Storynotes, in denen erklärt wird, unter welchen Bedingungen die jeweilige Erzählung entstanden ist. Beiseit: Dass irgendwann während des Schreibens von "The Father of Stones" ein gewisser Billy-Wilder-Film mit Marlene Dietrich im Fernsehen gelaufen sein muss, wird nicht erwähnt. Passend zu Shepards abwechslungsreichem Leben können die Hintergründe mal banal sein, mal auch Geschehnisse umfassen, die selbst Stoff für Romane hergeben würden. Etwa wenn Shepard die langen Zeiten anspricht, die er in Mittelamerika verbracht hat. In der letzten und jüngsten Griaule-Geschichte, "The Skull", spiegeln sich diese persönlichen Erlebnisse am deutlichsten wider. Darin reisen wir - zeitlich mittlerweile in der Gegenwart angekommen - in ein Land, das von Elend, Korruption und faschistischen Todesschwadronen geplagt wird. In diesem Hinterhof der USA tritt der Drache einmal mehr - diesmal als menschlicher "Jefe" - in Erscheinung, um sein Netz aus Gewalt und Bosheit zu spinnen.
... womit Shepard den Bogen zur ältesten Geschichte zurückschlägt. Denn BDOs mögen Projektionsflächen für vieles sein und Griaule könnte man als Metapher für jedes beliebige Phänomen heranziehen, welches das Denken und Fühlen der Menschen auf unentrinnbar erscheinende Weise prägt. Doch für "The Man Who Painted the Dragon Griaule" hatte Shepard seinerzeit ein ganz konkretes im Auge: Die Reagan-Administration und ihre skrupellosen Umtriebe in Lateinamerika. Falls er in Zukunft noch weitere Griaule-Geschichten schreibt, werden sie in die Richtung des hochpolitischen "The Skull" gehen, hat Shepard angekündigt. Für das Fantasy-Genre eindeutig eine Bereicherung.
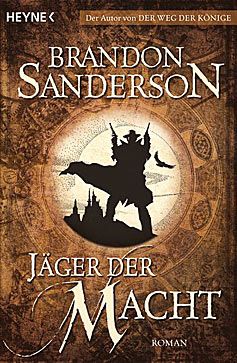
Brandon Sanderson: "Jäger der Macht"
Broschiert, 413 Seiten, € 14,40, Heyne 2012 (Original: "The Alloy of Law", 2011)
[Keine Ahnung, worauf sich der deutsche Titel bezieht ... ups, pardon, ich bin schon auf Sendung ...] Drei Jahrhunderte, nachdem die "Mistborn"-Trilogie von Fantasy-Erfolgsautor Brandon Sanderson in kataklysmischen Ereignissen endete, und zugleich drei Jahre Realzeit später finden wir uns auf der Welt Scadrial wieder. Und die Welt hat sich weitergedreht, wie Stephen King das in seiner "Turm"-Reihe so schön ausdrückte. Die Helden von einst sind zu religiös verbrämten Legenden geworden (was den einen oder anderen Cameo-Auftritt nicht ausschließt), dafür hat das High-Fantasy-Setting Platz gemacht für Dampflokomotiven, Elektrizität, Handfeuerwaffen (jede Menge Handfeuerwaffen) und sogar soziologische Konzepte wie die Broken-Windows-Theorie. Ähnlich wie bei Thomas Plischkes Reihe "Die zerrissenen Reiche" erleben wir, wie eine Fantasy-Welt in eine neue historische und technologische Epoche eintritt.
Zentrum des Geschehens ist die Millionenmetropole Elantel, die übrigens nur auf Deutsch Assoziationen an Sandersons Debüt-Roman "Elantris" weckt, im Original heißt sie Elendel. Sie liegt inmitten eines dicht besiedelten zivilisierten Beckens, während außerhalb der dieses umschließenden Bergketten das Rauland liegt; oder anders ausgedrückt: der Wilde Westen. Mit allem, was dazugehört. Und weil die magischen Kräfte von Allomantie und Ferrochemie, die der konzeptfreudige Sanderson für seine "Mistborn"-Reihe entwarf, immer noch wirken und ihren TrägerInnen fantastische Fähigkeiten verleihen, haben wir es mit Fantasy zu tun, die sich zu gleichen Teilen aus den Genres Steampunk, Western und Superheldengeschichte speist.
Hauptfigur des Romans ist Waxillium "Wax" Ladrian, ein Münzwerfer. Soll heißen: Er kann eine Abstoßungskraft zwischen sich und Stahl erzeugen, die - je nach Masseverhältnis - entweder das Metall oder ihn selbst in beschleunigte Bewegung versetzt. Superleicht bzw. superschwer machen kann er sich darüberhinaus auch. Sein Kumpel Wayne wiederum verfügt über Selbstheilungskräfte und vermag eine Zeitblase um sich zu erzeugen, in der er übermenschlich schnell ist (allerdings anders als The Flash ortsgebunden bleibt). Sanderson ist konzeptfreudig, wie gesagt: Dem Roman ist ein Glossar angefügt, in dem die sinnverwirrende Vielfalt allomantischer und ferrochemischer Fähigkeiten, die sich aus der Manipulation diverser Metalle und Legierungen ergibt, durchexerziert wird. Das liest sich wie die Anleitung zu einem Rollenspiel der komplizierteren Art ... muss glücklicherweise aber keineswegs auswendig gelernt werden, um den Roman zu verstehen. Fans der "Mistborn"-Reihe haben gegrummelt, dass die magische Metallhandhabung in "Jäger der Macht" keine so große Rolle spielt wie in den Romanen zuvor; NeueinsteigerInnen hingegen dürfen erleichtert aufatmen. Und ganz davon abgesehen: Waynes ganz un-magische Verkleidungskünste sind mindestens so unterhaltsam wie der ganze Metallkram.
Wax & Wayne (im Englischen ein hübsches Wortspiel) waren ursprünglich als Gesetzeshüter im Rauland umtriebig - bis Wax als Erbe eines bedeutenden Handelshauses nach Elantel zurückgerufen und mit dem Umstand konfrontiert wird, dass die ökonomischen Fähigkeiten eines Bruce Wayne manchmal wichtiger sind als die eines Batman. Für kurze Zeit zumindest, denn schon bald widmet er sich einer Aufsehen erregenden Verbrechensserie: Ganz wie im Wilden Westen werden Züge überfallen, ihre Fracht plus einige Geiseln verschwinden auf unbekannte - und wie sich letztlich zeigen wird: sehr raffinierte - Weise ins Nirvana. Genau die richtige Herausforderung für Wax und den anarchisch-sympathischen Wayne.
"Jäger der Macht" lebt nicht zuletzt vom witzigen Zusammenspiel der beiden männlichen Protagonisten, zu denen sich bald noch eine Frau gesellt. Marasi ist das schüchterne Mündel eines reichen Bürgers, aber belesen im doppelten Sinne: Akademisch gebildet nämlich und trotzdem auch glühender Fan der billigen Abenteuerhefte, in denen die Erlebnisse von Wax & Wayne unters Volk gebracht werden. Wie man es von der weiblichen Hauptfigur eines Phantastik-Romans dieser Tage erwarten darf, wird Marasi noch ihre Frau stehen. Es spricht aber für Sandersons vergleichsweise klischeefreie Charakterdarstellungen, dass sich Marasi bei aller Einsatzfreude doch eingesteht, dass sie bleihaltige Abenteuer lieber liest als selbst erlebt.
Und genau das ist "Jäger der Macht" auch: ein nettes Abenteuer. Nur seine Einordnung gibt mir noch ein wenig Rätsel auf. Angeblich hat Sanderson es "so zwischendurch" geschrieben, um den Kopf freizubekommen. Andererseits spricht er davon, dass noch zwei weitere "Mistborn"-Trilogien folgen sollen, von denen eine in einem urbanen und eine in einem futuristischen Setting angesiedelt sein wird. Der angebliche Standalone-Roman "Jäger der Macht" würde ersterem bereits entsprechen und lässt zudem einige Enden offen, die eine Fortsetzung jederzeit ermöglichen würden. Mal sehen, ob Sanderson Wax & Co noch mal aufgreift. Verwundern würde es nicht: Mit einem Output von zwölf(!) Romanen seit 2005 hat sich der heute 36-Jährige aus dem Stand in die Reihen der Fleißigsten seiner Zunft katapultiert.
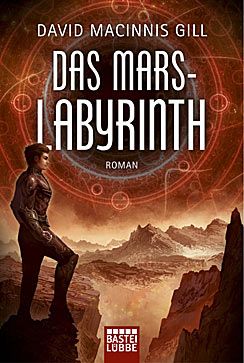
David Macinnis Gill: "Das Mars-Labyrinth"
Broschiert, 332 Seiten, € 9,30, Bastei Lübbe 2012 (Original: "Black Hole Sun", 2010)
Hier haben wir es mit einem der raren Fälle zu tun, in denen der deutschsprachige Titel nachvollziehbarer ist als der des Originals. Immerhin halten wir uns die Hälfte von David Macinnis Gills erstem SF-Roman in Minenschächten unter der Oberfläche des Mars auf. Eines Mars, der vor ein paar Generationen besiedelt und teilweise terraformiert wurde. Die Lichter der prosperierenden Äquatorstädte sehen wir aber nur von Weitem - da, wo sich die ProtagonistInnen aufhalten, ist der Mars heruntergekommen, verrostet, dreckig und brutal. Und er stinkt.
Vor diesem düsteren Hintergrund steckt Hauptfigur Durango - eigentlich Jacob Stringfellow, ein Name, den er aus gutem Grund verschweigt - in seiner ganz persönlichen Hölle. Einst ein angesehener Regulator der Mars-Regierung, verdingt er sich nun als Söldner; in Ungnade gefallen, weil er den seinerzeit von ihm erwarteten rituellen Selbstmord nicht begangen hat. Eigentlich hat ihn sein Vater aus egoistischen Gründen daran gehindert - was den alten Mann aber nicht davon abhält, seinen Sohn mit Vorwürfen zu überschütten, wenn der ihn mal im Gefängnis besucht. Der Job ist gefährlich und schlecht bezahlt, seine KundInnen begegnen dem Paria (bzw. Dalit) Durango mit Verachtung - und zu allem Überfluss hat er auch noch mit seinem Ehrgefühl zu ringen, das er trotz gesellschaftlicher Ächtung keineswegs abgelegt hat. Spät liest man mit Erstaunen, dass Durango in Erdjahren gemessen erst 17 ist - fühlt sich eher nach den 49 von Macinnis Gill an.
Die Handlung des Romans ist letztlich eine Variation der "Glorreichen Sieben": Unterprivilegierte MinenarbeiterInnen heuern Durango an, damit er ihre Siedlung gegen die Überfälle einer Horde von Menschenfressern verteidigt. Und mit Durangos potenziellem Love Interest Vienne sowie ein paar Komparsen sind es tatsächlich sieben KämpferInnen, die sich auf den Weg ins Minen-Labyrinth machen - zumindest wenn man den Flash-Clone Mimi miteinrechnet: Eine digitale Bewusstseinskopie von Durangos verstorbener Vorgesetzter, die ihm ins Gehirn implantiert wurde. Ganz an den Haaren herbeigezogen ist der Verweis übrigens nicht. Dass Macinnis Gill sich gerne auch mal in der Filmgeschichte bedient, zeigt eine Passage, in der zwei Romanfiguren ihre Narben vergleichen wie Quint und Hooper im "Weißen Hai".
Menschenfresser also, und zwar solche von - nicht zu ihrem Vorteil - veränderter Gestalt; angeführt werden diese Dræu genannten Kannibalen dafür von einer ebenso schönen wie sadistischen Königin. Es ist ein ziemlich wildes Garn, das der Autor aus den Südstaaten der USA da spinnt - und ohne große Mühe wäre seine pulpige Abenteuergeschichte in ein anderes Setting übertragbar. Ohnehin lassen Königin und Anhang an Orks und Dunkelelfen denken. Den Ursprung der Dræu (wenn auch nicht ihres Namens) erfahren wir am Ende des Romans, vieles andere bleibt aber offen. Zum Beispiel warum Durangos Vater seinen Sohn als künftigen "König des Mars" sieht - John Carter lässt grüßen. Da kommen dann vielleicht weitere Romane ins Spiel, der nächste ist unter dem Titel "Invisible Sun" diesen März erschienen.
Noch ist vieles lückenhaft und bedürfte weiterer Ausarbeitung. Das gilt für die religiösen Aspekte von Durangos Weltbild (anscheinend eine Mischung aus Samurai-Ideologie und nordischer Mythologie, wie aus dem Nichts taucht der Begriff "Walhalla" auf), erst recht aber für das Setting. Von der Erde erfahren wir kurz, dass sie durch eine Seuche entvölkert wurde, und auch von den politischen Rahmenbedingungen auf dem Mars kann man sich noch kein rechtes Bild machen. Die Orthokratie genannte ehemalige Machtelite - offenbar eine religiös-autoritäre Regierung - wurde von der gänzlich diffus bleibenden CorpCom abgelöst. Aber zugegeben: Für die Underdogs, die die Hauptfiguren des Romans stellen, macht das ohnehin keinen Unterschied.
Eher schon ein Problem sind die auf Dauer etwas ermüdenden Kabbeleien speziell zwischen Durango und Mimi, aber auch zwischen den anderen ProtagonistInnen. Ohne Unterlass - und auch in gänzlich unpassenden, weil lebensgefährlichen Situationen - zieht man sich gegenseitig auf, und es sind nicht immer die brillantesten Pointen, die sie einander da auflegen. Vielleicht ist diese zur Auflockerung gedachte Sprücheklopferei des Autors Vorstellung davon, was einen Young-Adult-Roman von einem "schweren" erwachsenen Stoff unterscheidet, wer weiß. Ich habe schon Vergleiche mit Han-Solo-Kommentaren gelesen. Doch hat uns ja gerade die "Star Wars"-Historie eines gelehrt: Weniger kann oftmals mehr sein ...

Aleksei Bobl & Andrei Levitski: "Tekhnotma. Zeit der Dunkelheit"
Broschiert, 476 Seiten, € 15,50, Heyne 2012 (Original: "Parol: Vechnost - Tekhnotma ", 2010)
Nach all den Jahren des SF-Lesens fasziniert es mich immer noch, wie AutorInnen postapokalyptische Wüsteneien entwerfen, in denen am unteren Ende der Nahrungskette tote Hose herrscht, sich dafür aber übergroße Top-Predatoren gegenseitig auf die Füße steigen. Vielleicht halten ja heimlich irgendwelche Entenfütter-Omas im Godzilla-Format das Ökosystem aufrecht: Denen würde ich mal einen eigenen Roman gönnen. - Verlassen wir also die Welt der Vernunft und stürzen uns in den düsteren Strudel von "Tekhnotma". Die beiden Autoren Aleksei Bobl & Andrei Levitski haben bislang für die Romanserie gearbeitet, die das ukrainische Egoshooter-Spiel "S.T.A.L.K.E.R." von GSC Game World begleitete. Fast folgerichtig werden sich nicht nur die Hauptfigur, sondern auch die LeserInnen des Romans fragen, ob sie in einem Computerspiel gelandet sind.
Zwei Kapitel reichen den Autoren, um die Gegenwart bzw. nahe Zukunft abzuhandeln, aus der unser Held wider Willen in eine weiter entfernt liegende Zeit versetzt wird. Der Söldner Jegor Rasin wird in den Wirren eines ukrainischen Bürgerkriegs festgenommen und vor die Wahl gestellt: Entweder nimmt er an einem wissenschaftlichen Experiment teil oder er wird hingerichtet. Klarerweise entscheidet er sich für Ersteres und findet sich kurz darauf bereits in den Ruinen des Forschungsinstituts wieder. Offensichtlich sind im Zeitraffer reichlich Jahre verstrichen, denn draußen hat sich die Welt stark verändert. Allerlei gefährliche Megafauna (Mutafage genannt) und anthropomorphe Mutanten treiben ihr Unwesen im Land, dazu breitet sich mit der Nekrose eine Art tödlicher Super-Schimmel aus, der mit Ausnahme von Eisen sämtliche lebende und tote Materie überzieht. Last but not least wären da noch riesenhafte Fluginseln, die gelegentlich über den Himmel ziehen. Alles in allem eine ganze Menge Fragen, die es zu klären gilt, von denen am Ende aber noch viele offen bleiben werden. "Zeit der Dunkelheit" ist der erste Roman einer Serie, die Fortsetzung erscheint im März nächsten Jahres.
Von den alten politischen Strukturen ist nichts geblieben. In der neuen Mad-Max-Welt haben sich die wenigen übrig gebliebenen Menschen in verstreut lebenden Clans organisiert, die sich entweder rings um Erdölquellen angesiedelt oder auf die Produktion begehrter Waren (bzw. Waffen) spezialisiert haben. Wie der Mecha-Korpus, dessen Kolonie langsam von der Nekrose eingeschlossen wird. Als letzte verzweifelte Maßnahme hat der Machthaber des Mecha-Korpus seine Tochter June Galo hinaus in die Welt geschickt, um Hilfe zu holen. In der Stunde höchster Not trifft sie auf Jegor, der sich widerwillig bereit erklärt, sie nach Moskau zu begleiten, wo sie sich Hilfe und er sich Aufklärung darüber verspricht, was zum Teufel eigentlich mit der Welt passiert ist. Ein Glück, dass June im richtigen Moment der Ärmel verrutscht ist und ein Tattoo enthüllt hat, welches dasselbe Muster zeigt wie der Siegelring des Wissenschafters, der Jegor einst auf seine Zeitreise geschickt hat. Man stelle sich vor, das Textil hätte gehalten - dann wäre der Pakt zwischen den beiden nie zustande gekommen ...
Mehr als einmal fragt Jegor sich, ob er sich im Inneren eines Computerspiels befindet und die Nekrose womöglich ein Virus ist, das diese virtuelle Welt langsam auffrisst. Eine zeitgenössische Interpretation, aber rein literarisch kann man "Tekhnotma" auch in einen viel älteren Kontext stellen: Letztlich ist der Roman purer Pulp in der Tradition von Edgar Rice Burroughs bis Kenneth Bulmer. Mittels Voodoo-Technologie wird ein Held in ein gefährliches Setting versetzt, wo Monster, schießwütige Feinde und sonstige Gefahren lauern - und seine erste Tat in der neuen Welt ist es, eine Prinzessin (bzw. die postapokalyptische Entsprechung einer solchen) zu retten. Er wird mit geheimnisvollen Mächten wie dem Mönchsorden und knalligen Begrifflichkeiten - es gibt sogar ein Schloss Omega! - konfrontiert und bewährt sich dank überdurchschnittlicher geistiger und körperlicher Fähigkeiten.
Hier zeigt sich aber auch ein Unterschied zu den Pulp-Vorgängern: Anders als Burroughs' John Carter oder Bulmers Dray Prescot (oder Philip José Farmers Richard Francis Burton, wenn wir schon beim Thema sind), lässt Jegor seine Überlegenheit nicht penetrant raushängen, sondern grummelt sich eher widerwillig durch seine Abenteuer. Der tief in ihm verwurzelte Widerspruchsgeist macht Jegor durchaus sympathisch.
Vielleicht mag sich der eine oder die andere auch deshalb an ein Computerspiel erinnert fühlen, weil die RomanprotagonistInnen von einer Gefahrenkulisse zur nächsten wechseln - ganz so, als bewegten sie sich von einer Spielebene zur anderen (siehe etwa eine für die Gesamthandlung entbehrliche Odyssee durch die Moskauer U-Bahn-Tunnel). Aber da unterscheiden sich Bobl & Levitski genau genommen nicht von anderen zeitgenössischen AutorInnen, die keinen Spiele-Hintergrund haben. Denn auch z.B. bei Cherie Priest ("Boneshaker") oder Gavin Smith ("Der Veteran") wird gelaufen und geschossen und gelaufen und geschossen; und letztlich herrscht rasender Stillstand. Zumindest wer Action um der Action willen liebt, ist bei "Tekhnotma" recht gut bedient. Ein neuer Sergej Lukianenko wird allerdings immer noch gesucht.
Apropos Stillstand: Nach einem gewissen Durchhänger zwischen Frühling und Sommer drängen jetzt wieder mehr interessante Titel auf den Markt. Beim nächsten Mal stehen unter anderem der neue Geschichtenband von James Tiptree Jr. und ein Ticket für zwei nach Cyberabad auf dem Programm; China Miévilles "Stadt der Fremden" könnte sich mit etwas Timing-Glück auch noch ausgehen. Außerdem werden wir uns entweder im August oder spätestens im September dem gefährlichsten Buch des Jahres 2012 widmen ... (Josefson, derStandard.at, 21. 7. 2012)