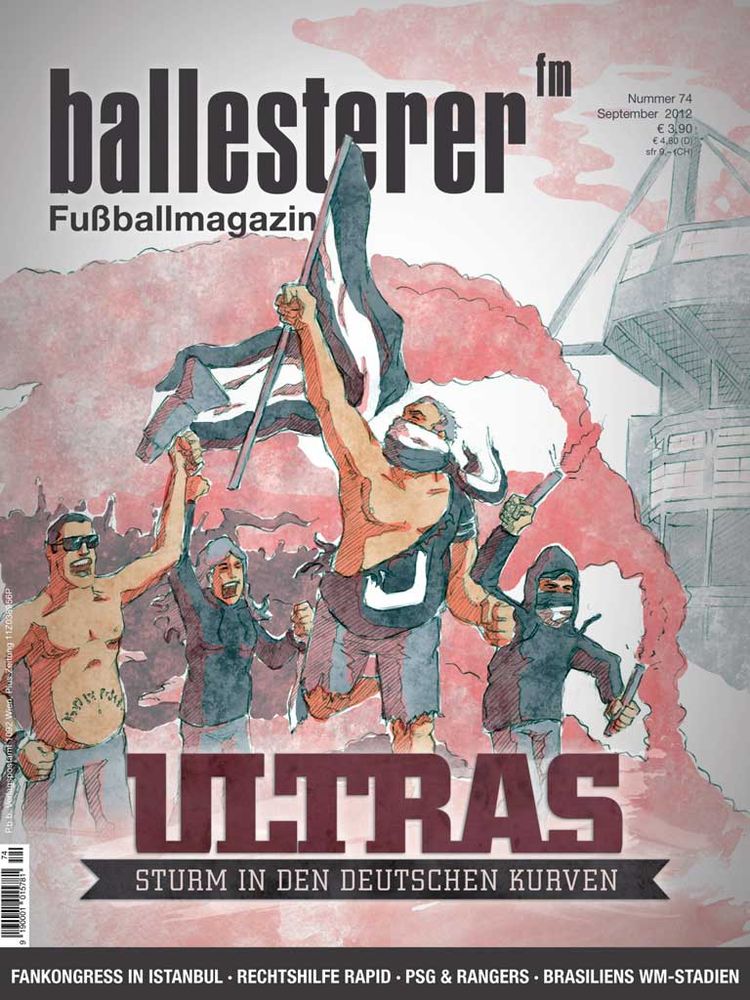Für Fußball interessiert sich Rafael Behr nicht besonders. Dafür umso mehr für die Polizei, der er selbst angehört hat und mit deren »Cop Culture« er sich heute als Soziologe an der Polizeihochschule in Hamburg beschäftigt. Behr kann erklären, was passiert, wenn der Helm aufgesetzt wird, warum auch Polizisten den Rausch der Gruppe kennen und wieso sie mit der Kultur der Fußballfans Probleme haben.
ballesterer: Wie definieren Polizisten ihre eigene Rolle?
Rafael Behr: Eine wichtige Basis jeder polizeilichen Selbstbeschreibung ist es, zu den Guten zu gehören. Es gibt keine Kultur der »Bad Boys«. Diese Grundannahme muss nicht erklärt werden. Wenn wir an die geschlossenen Einheiten der Bereitschaftspolizei denken, die oft für Fußballeinsätze verantwortlich sind, geht es dort zunächst um Autoritätserhalt. Diese Einheiten kommen selten mit dem Bürger in Berührung, der eine Dienstleistung braucht. Das prägt ihr Selbstbild. Wo sie auftauchen, gibt es Stress und Konflikt. Das sind Kriegermännlichkeiten, die einen Gegensatz aufbauen zwischen »Wir hier drinnen« und »Die da draußen«. Was nicht drinnen ist, ist suspekt. Die geschlossenen Einheiten neigen zur Abschottung, sie halten das, was an Einschätzungen von außen kommt, schnell für sinnlose Theorie. Das kommt nicht aus der eigenen Erfahrung und hat daher keine Relevanz.
Wie werden die eigenen Erfahrungen weitergegeben?
Das passiert auf den Gruppenwagen, während der Pause oder während man auf den Einsatz wartet. Die Polizei ist auch eine Erlebnisgemeinschaft. Die Erlebnisse, die sie zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit Fans hat, bilden einen Pool von Mythen und Geschichten, die erzählt und in das Selbstbild eingearbeitet werden. Das dient nicht nur dem Sich-gegenseitig-auf-die-Schultern-Klopfen, sondern auch für Warnungen, worauf man aufpassen muss. Ein typisches Muster dieser Erzählung ist: »Heute kannst du mit denen nicht mehr reden, die haben keinen Anstand mehr, die treten noch auf dich ein, wenn du am Boden liegst.« Der Rückgriff auf eine frühere, bessere Welt, als der Hooligan noch sportlich kämpfte und aufhörte, wenn er eine gebrochene Nase hatte, wird stark zelebriert. In der öffentlichen Darstellung wird die Erlebnisdimension der Polizei jedoch unterschlagen. Dabei übt man nicht nur einen Beruf aus, sondern ist auch affektberührt.
Was bedeutet das genau?
Das geht auch an mir nicht vorbei. In der Nacht vor dem 1. Mai (in der es im Hamburger Schanzenviertel häufig zu Auseinandersetzungen mit Jugendlichen kommt, Anm.) war ich als Beobachter mit einer Hundertschaft unterwegs. Zunächst war in der Schanze nichts los, sie mussten also in der Kaserne bleiben, sind herumgesessen und haben sich Witze erzählt. Um halb zwölf kam es doch zu einer kleinen Rangelei, und es wurde entschieden, dass wir losfahren. Wenn es heißt »Einsatz, Alarm, Alarm«, geht das Adrenalin schon ein bisschen hoch. Man fährt dann in einer Kolonne mit 20, 30 Autos durch die nächtliche Stadt. Die ersten Wagen schaffen's noch bei Grün über die Ampel, der Rest fährt bei Rot drüber. Die ersten drei machen die Blaulichter an, die letzten zehn dann noch das Martinshorn. Und da sieht man sich um und denkt: »Ich bin Teil davon, die Leute bleiben stehen und schauen alle auf uns.« Da kriegt man eine Gänsehaut. Aber das kannst du niemandem erzählen. Der Vorgesetzte würde nur sagen: »Spinnen Sie, haben Sie etwa Spaß daran?« Doch die Polizisten spüren, dass sie nicht allein sind und dass sie stark sind.
Das fühlt sich vielleicht ähnlich an, wenn eine Ultra-Gruppe in einen fremden Bahnhof einläuft ...
Ja, das ist eben ein adoleszenter Rausch, weil man als Gruppe unverwundbar scheint. Viele Polizisten sind ja spätadoleszent, genauso wie viele Fans. Aber das dürfen sie nicht thematisieren, weil die Trennung zwischen Polizei und Gegenüber betont werden muss. Die Polizisten »verrichten ihren Dienst«, lautet die Formulierung. Dass sie auch Spaß an den vielen kleinen und großen Erlebnissen haben, wird offiziell ausgespart.
Wie wird über Gewaltausübung gesprochen? Zum offiziellen Selbstbild gehört das ja nicht.
Das ist frappierend, oder? Aber es gibt heute eine sehr vernünftige Polizeiausbildung, da wird niemand scharf gemacht. Polizisten lernen, sich defensiv, aber dennoch deutlich durchzusetzen. Richtige Rambo-Typen werden ausgefiltert. Im Vergleich zu anderen Polizeien in Europa geht es in Deutschland viel um Kommunikation. In der Praxis ist es anders. Da wird auch reflektiert, aber aus der Betroffenheitslage: »Wir sind potenzielle Opfer. Wenn wir zu schwach auftreten, werden wir geschädigt. Wenn wir zu stark auftreten, werden wir in der Öffentlichkeit kritisiert.« Die Polizei rüstet sich aus dieser Logik heraus auf, weil sie sich Verletzungen ersparen will. Man braucht schwere Helme, weil die anderen kaputtgehen. Die Nebenwirkung ist, dass die Beamten immer unmenschlicher und gepanzerter aussehen und irgendwann als Robocops wahrgenommen werden. Dennoch: Was die Polizei generell angeht, glaube ich nicht, dass das entgleist. Aber in manchen Situationen wird die gelernte Grundhaltung durchbrochen. Zum Beispiel, wenn eine Anhäufung von jungen, männlichen Polizisten nicht genügend durch Vorgesetzte begleitet wird. Da kann sich schnell eine Verselbstständigung der Gerechtigkeitsauffassung und des Autoritätserhalts entwickeln. Die machen dann Dinge jenseits der Ausbildungsinhalte.
Im deutschen Fußball spielt der insbesondere von den Polizeigewerkschaften vorgetragene Vorwurf einer zunehmenden Gewalt gegen Polizisten eine große Rolle.
Grundsätzlich sinkt die Gesamtgewalt, die der Polizei in Deutschland entgegengebracht wird. Für die Behauptung, dass diese Gewalt steigt oder schlimmer wird, gibt es keine empirischen Grundlagen. Aber wenn die Gewerkschaft der Polizei sagt, für uns ist schon Beleidigung Gewalt, dann haben wir einen ganz anderen Gewaltbegriff als körperliche Gewalt. Zählen da Dinge wie Spucken oder ACAB-Tätowierungen (All Cops Are Bastards, Anm.) dazu? Wenn man genauer hinschaut, geht es hier eher um die Nichtunterwerfung unter die polizeiliche Autorität. Da ist problematisch, dass Polizisten so wenig wissen, mit Respektlosigkeiten umzugehen, aber sehr gut wissen, mit Gewalt umzugehen. Und da sie im Handlungsfeld Gewalt sicher sind, in der Vorstufe aber unsicher, wird der Geltungsrahmen von Gewalt immer weiter ausgeweitet. Wir müssen mehr Freundlichkeit, Souveränität und Selbstbewusstsein in die Köpfe bekommen.
Hohn und Spott gegen die Polizei beispielsweise auf Spruchbändern sind Bestandteil der Fankultur. Wie wird das aufgenommen?
Das ist schwer zu verdauen, zumal wenn es eloquent daherkommt. Die intelligent vorgetragene Verarschung von Polizisten ist ein Katalysator für Gewalttätigkeit. Die Herrschaftsansprüche des Staates infrage zu stellen und einen Polizisten auszulachen ist immer gefährlich. Es geht symbolisch ganz oft um den Erhalt des eigenen Anspruchs auf Autorität. Und das wird heute in weiten Teilen der Gesellschaft schon anders gesehen als bei den meisten Polizisten, die eben noch nach recht konservativen Vorstellungen sozialisiert werden. Außerdem sind Polizisten, vielleicht wegen ihrer uneinschätzbaren Klientel, unendlich bedürftig nach Liebe, Harmonie und Ordnung.
Leidet die Polizei unter einem veralteten Autoritätsbegriff?
Sie basiert auf einem sehr vereinfachten Gesellschaftsmodell, in dem der Bürger als »polizeiliches Gegenüber« definiert wird und man davon ausgeht, dass er sich prinzipiell »ordnungsgemäß« verhalten kann. Das ist aber eine Erwartungshaltung, die viele Menschen in ihren heutigen prekären Lebensverhältnissen gar nicht mehr erfüllen. Die meisten Polizisten kommen dagegen aus gut behüteten Mittelschichtfamilien. 90 Prozent haben Abitur, keine Allergien, haben von ihren Eltern einen vollständigen Impfschutz bekommen und sind verbeamtet. Sie haben keine Erfahrung mit Prekariat, Bildungsdefiziten und Arbeitslosigkeit. Polizisten haben mit der problematischen Klientel als Gegenüber biografisch nichts gemeinsam. Die »offizielle« Polizei sagt zum Bürger heute »Kunde«, und sie bezeichnet sich selbst als Dienstleistungsunternehmen. Aber in den Köpfen der meisten Polizisten war und ist der Bürger in erster Linie ein »Herrschaftsunterworfener«. Das ist schon ein Widerspruch, und der erzeugt Konflikte.
Eine Erwartung von Fußballfans an die Polizei ist Transparenz, also: »Sagt uns, was ihr macht« und »Wenn ihr wollt, dass wir etwas machen, sagt uns, warum.« Ist das überhaupt realistisch?
Die Frage nach dem Warum ist immer Ungehorsam (lacht), aber sie zeugt von einem aufgeklärten Subjekt. Die Polizei sagt, es gibt Situationen, da kann man nicht mehr erklären. Aber da werden viele Räume im Vorfeld, in denen erklärt werden kann, einfach abgeschnitten. Wenn ein Polizeiverantwortlicher nicht will, wird nicht kommuniziert, und wenn er es will, passiert es auch. Im Einsatz werden oft nur noch Befehle gegeben und es wird gemacht, da kann man nicht mehr innehalten. Wenn der Helm auf ist, wird auch miteinander nicht mehr viel geredet. Da verlässt man sich auf eingeübte und ritualisierte Handlungen. Mitten im Lauf einzuhalten und zu sagen »Moment, vielleicht gehen wir wieder zurück« geht nicht.
Welche Rolle spielt Männlichkeit in der »Cop Culture«?
Auch wenn es da Veränderungen gegeben hat, ist sie ist immer noch dominant - speziell bei Sporteinsätzen. Frauen haben dort eine schwierige Rolle. Die kann man nicht so einsetzen wie Männer, wenn es hart auf hart kommt, heißt es. Sie gelten als schwächstes Glied in der Gruppe und können den Job an der Front nicht so gut erledigen, weil sie ihre Stärke eher in der Kommunikation haben. Frauen werden auffällig oft als Fahrerinnen eingesetzt, aber sie dürfen nicht Kriegerinnen sein. Das ist auch eine Form konservativer patriarchaler Männlichkeit.
Spielt das bei der sogenannten Vollkörperschutzausstattung denn eine Rolle? Man sieht doch eh kaum, ob man einen Mann oder eine Frau vor sich hat.
Für das Gegenüber vielleicht nicht, intern spielt das schon eine Rolle. Die Anfälligkeit, selbst in die Gewaltspirale einzusteigen, ist bei Männern größer als bei Frauen. Ich habe kürzlich bei einer Demo Polizisten beobachtet, die unter ihrem Helm Sturmhauben getragen haben, sodass man nur die Augen sehen konnte. Das waren normale Bereitschaftspolizisten, keine Elitekämpfer gegen Al-Kaida, auch wenn sie sich so gegeben haben. Da wird Herrschaft auf archaische Weise zelebriert. Das ist nicht das richtige Angebot an die Gesellschaft. Das ist nicht die Polizei, die ich will. (Nicole Selmer)