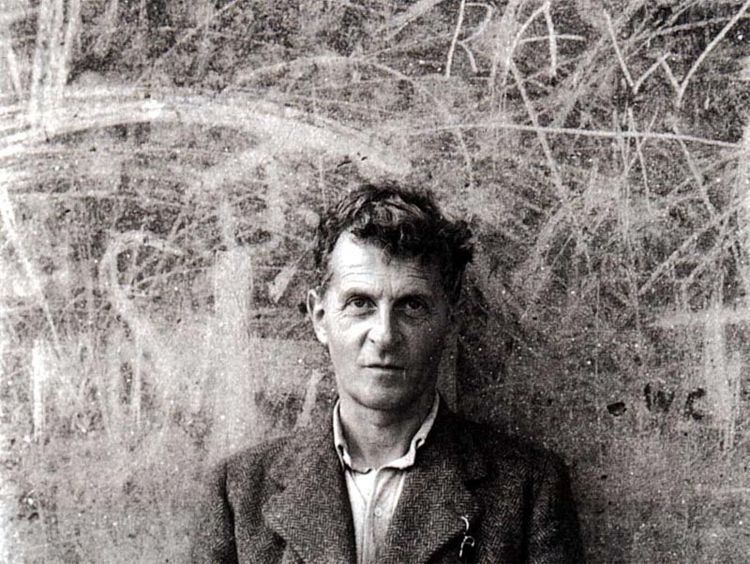STANDARD: Österreichs wichtigster Preis für Wissenschafter ist ebenso nach Ludwig Wittgenstein benannt wie seit kurzem ein Lesesaal der Österreichischen Nationalbibliothek. Was machte Ludwig Wittgenstein zu einem Denker, der auch heute öffentlich noch so präsent ist?
Kusch: Wittgensteins Wirkung auf die breitere Öffentlichkeit hat gewiss auch damit zu tun, dass seine Persönlichkeit irgendwie spannender und facettenreicher ist als die vieler anderer Philosophen des 20. Jahrhunderts. Dazu trägt natürlich auch seine Biografie bei – die eines Österreichers, der aus einer absurd reichen Familie stammt und der einen Großteil des riesigen Vermögens verschenkt. Das fasziniert ebenso wie sein Wechsel vom deutschen Sprachraum in den englischen. Und dass er an die Universität Cambridge ging, die damals ein Zentrum der Philosophie war, hat für seine Rezeption auch geholfen.
STANDARD: Wie steht es um Wittgensteins Bedeutung in der Philosophie?
Kusch: Wittgenstein war vor allem von etwa 1960 bis 1990 in der angloamerikanischen Philosophie sehr wichtig, und zwar in ganz verschiedenen Bereichen: der Sprachphilosophie, der Philosophie des Geistes oder der Erkenntnistheorie. Mit dazu bei trug auch, dass Wittgenstein ein glänzender Stilist war.
STANDARD: Welche Rolle spielt Wittgenstein in der Philosophie heute?
Kusch: In den vergangenen 20 Jahren hat seine Bedeutung abgenommen. Er ist inzwischen kanonisiert – so wie Martin Heidegger, Edmund Husserl oder Jacques Derrida. Das heißt leider auch, dass die Erforschung seines Werks heute mehr und mehr von Spezialisten betrieben wird, deren Detailarbeiten und interne Fehden für die allgemeine philosophische Diskussion jenseits der Wittgenstein-Forschung eher uninteressant sind. Aber es entstehen selbstverständlich weiterhin wichtige Beiträge, etwa im Umkreis der Erkenntnistheorie.
STANDARD: Sie haben lange in Cambridge gearbeitet. Gab es dort zu Ihrer Zeit noch Nachwirkungen von Wittgenstein zu spüren?
Kusch: Das mit dem angeblichen Wittgenstein-Kult in Cambridge war immer ein bisschen übertrieben. Er hatte dort nur etwa ein Dutzend Studenten um sich geschart und nie Vorlesungen vor hunderten von Studenten gehalten, wie ich es hier Wien tun darf. Außerdem gab es in Cambridge neben ihm andere einflussreiche Philosophen wie Bertrand Russell. In der nächsten Generation aber, als etwa die Wittgenstein-Schülerin Elizabeth Anscombe selbst Professorin in Cambridge wurde, da bildete sich schon so etwas wie eine Art Wittgenstein-Kult heraus. Doch als ich 1997 nach Cambridge kam, war davon kaum mehr etwas zu bemerken. Da wurde Wittgenstein eher wie ein „toter Hund" behandelt.
STANDARD: Für Wittgenstein wird immer wieder ein besonders enger Zusammenhang von Leben und Werk behauptet. Trifft das Ihrer Meinung nach zu?
Kusch: Es gibt Arbeiten, die das Werk Wittgensteins und seine Biografie engführen. Aber das Biografische scheint mir da doch zu wenig eingebettet in die weiteren sozialen und politischen Kontexte seiner Zeit, die ihn zweifellos geprägt hat. Stattdessen geht es, wie auch in Ray Monks großer Wittgenstein-Biografie, meist doch um das einsame Genie und den reinen, hehren Denker, der alles aus sich selbst entwickelt.
STANDARD: Aber es gab doch auch Bücher wie „Wittgensteins Wien" von Allan Janik und Stephen Toulmin, in dem gezeigt wird, wie Wittgensteins Philosophie von diesem speziellen Wiener Kontext der zu Ende gehenden Monarchie geprägt war.
Kusch: Das stimmt schon. Aber ich sage meinen Studenten immer, dass man parallel zu diesem Buch Brigitte Hamanns brillante Studie „Hitlers Wien" lesen sollte, in dem es um die gleiche Zeit und die gleiche Stadt geht. Dadurch sieht man erst, wie wenig Wittgenstein anscheinend von den meisten sozialen Problemen seiner Zeit mitbekommen hat – man denke nur an die enorm wichtige Rolle der Sprachenpolitik in der späten Monarchie. Obwohl Wittgenstein als einer der bedeutendsten Sprachphilosophen des 20. Jahrhunderts gilt, findet sich von den politisch-ideologischen Problemen der Sprache nichts in seinem Werk.
STANDARD: In welchen Dingen war Wittgenstein ein Kind seiner Zeit?
Kusch: Das existenzialistische Element, das man bei ihm und in seinen Arbeiten um die Zeit des Ersten Weltkriegs findet, das fand man bei vielen anderen Intellektuellen dieser Zeit – geprägt nicht zuletzt durch den Krieg, aber etwa auch durch die Schriften Tolstois. In dem Zusammenhang war Wittgenstein alles andere als einzigartig, und es lässt sich etwa zeigen, dass Wittgensteins Arbeiten zur Religion von Tolstoi und später von Kierkegaard geprägt waren. Ein anderes Beispiel für die wichtige Rolle seines Umfelds sind seine Texte zum Thema Farbe, mit denen ich mich ein bisschen beschäftigt habe.
STANDARD: Worum geht es da?
Kusch: Wittgensteins Arbeiten zu den Farben wurde bisher immer als eine Auseinandersetzung mit Goethes Farbenlehre verstanden. Meines Erachtens kam Wittgenstein aber auf das Thema, als er 1913 an das psychologische Institut in Cambridge kam, das damals von Anthropologen geleitet wurde. Die hatten gut zehn Jahre zuvor eine Expedition in die Inselwelt zwischen Papua-Neuguinea und Australien gemacht und dabei die Farbwahrnehmung und das Farbvokabular der Bewohner dieser Inseln untersucht. Diese Forscher wollten damit beweisen, dass diese Menschen auf einem niedrigeren Entwicklungsniveau stünden, weil sie bestimmte Begriffe für Farben wie Blau nicht hatten. Wittgensteins Anmerkungen über die Farben sind nach meiner Überzeugung in weiten Teilen eine Kritik an diesen Arbeiten. Umgekehrt wollte ich damit zeigen, dass man Wittgenstein auf die Wissenschaft seiner Zeit beziehen muss, um auch seine Relevanz für heute besser einschätzen zu können.
STANDARD: Wie sehr hat sich Wittgenstein mit der Naturwissenschaft seiner Zeit befasst?
Kusch: Er hat sich immer dafür interessiert, wenn auch nicht so sehr wie die Mitglieder des Wiener Kreises. Womöglich hat er Einsteins Relativitätstheorie und neueren Entwicklungen der Physik nur durch Sekundärliteratur oder Gespräche mit Moritz Schlick rezipiert, jedenfalls aber doch sehr positiv aufgenommen. Ich habe selbst in einigen Arbeiten zu zeigen versucht, dass die Einstein'sche Uhrenkoordination und die Metrologie, also die Lehre von den Maßsystemen, für Wittgenstein eine wichtige Quelle für einige seiner zentralen Metaphern werden. Wittgenstein ist fraglos nicht gegen die Naturwissenschaft eingestellt – wohl aber gegen bestimmte pseudowissenschaftliche Ambitionen der Philosophie.
STANDARD: Würde sich Wittgenstein, wenn er unser Zeitgenosse wäre, in der heutigen akademischen Welt zurechtfinden? Hätte er da überhaupt eine Chance mit seiner Form des Denkens?
Kusch: Diese Fragen gelten zum einen nicht nur für Wittgenstein, sondern für die gesamte Generation seiner Zeit. Zum anderen darf man nicht vergessen, dass Wittgenstein, würde er heute leben, natürlich auch ganz anders akademisch sozialisiert worden wäre. Insofern läuft das Argument, dass Wittgenstein in der heutigen akademischen Welt wohl keine Chance hätte, etwas ins Leere. Hätte er das heutige Universitätssystem durchlaufen, würde er gewiss Projektanträge schreiben und Drittmittel einwerben. Und wahrscheinlich hätte er sich angewöhnt, etwas schneller zu schreiben und häufiger zu publizieren.
STANDARD: Sie haben kürzlich ein großes Forschungsprojekt in der Höhe von 2,5 Millionen vom Europäischen Forschungsrat bewilligt bekommen. Hätte Wittgenstein so wie Sie einen solchen Advanced Grant des ERC beantragt?
Kusch: Das ist natürlich eine sehr hypothetische Frage. Wittgenstein hat jedenfalls recht wenig mit anderen Leuten zusammengearbeitet, während es für dieses Projekt nötig ist, ähnlich wie in den Naturwissenschaften in einem Team zusammenzuarbeiten. Womöglich wäre diese Art der Teamarbeit für Wittgenstein eher unerträglich gewesen.
STANDARD: Sie scheinen damit wenig Schwierigkeiten zu haben, obwohl man sich Philosophen doch gemeinhin als einsame Denker vorstellt.
Kusch: Ich habe auch schon früher Fachartikel und Bücher gemeinsam mit Kollegen geschrieben. Für mich liegt gerade darin etwas besonders Reizvolles und Spannendes von solchen großen Projekten: gemeinsam forschen zu können. Meiner Arbeitsweise kommt das jedenfalls sehr entgehen, und ich bin davon überzeugt, dass Teamarbeit der Philosophie überhaupt nicht abträglich ist – im Gegenteil: Man lernt viel dabei, wenn man sich mit Kollegen ständig auseinandersetzen muss.
STANDARD: Wie wird Ihr Team zur Bearbeitung dieser Fragen aussehen und worum wird es gehen?
Kusch: Am Projekt werden vier Post-Docs und zwei Doktoranden mitarbeiten, die Post-Docs suche ich gerade aus. Und dann wird es für jedes Jahr angesehene Wissenschafter aus dem Ausland geben, die einige Monate hier in Wien mitarbeiten werden. Gemeinsam wollen wir die Herausbildung des Relativismus in verschiedenen Bereichen untersuchen, und zwar sowohl aus historischen, philosophischen wie auch soziologischen Perspektiven. Dazu gilt es verschiedene Teilprojekte – eines etwa über die Rolle der Naturwissenschaften beim Entstehen des Relativismus im 19. Jahrhundert oder den Relativismus in der Philosophie des Nationalsozialismus.
STANDARD: Waren die NS-Philosophen denn Relativisten?
Kusch: Diese Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Einerseits knüpften NS-Denker Vernunft an Rasse. Und da es ihrer Ansicht nach viele Rassen gab, war das ein Argument für den Relativismus. Man darf aber auch nicht vergessen, dass der Relativismus auch als Kosmopolitismus galt. Und das war quasi ein Synonym für jüdisch. Es gab also während der NS-Zeit heftige Debatten darüber, ob und wie der Relativismus mit dem Nazismus im Einklang stand oder nicht.
STANDARD: Gibt es für das Fach Philosophie viele solcher großer ERC-Projekte, die ja in der Scientific Community längst als Ausweis exzellenter Forschung gelten?
Kusch: Soweit mir bekannt ist, gingen seit der Einführung der Advanced Grants im Jahre 2007 nur acht solcher Projekte an Philosophen. Und gleich zwei davon an das Institut für Philosophie in Wien. Vor mir wurde bereits meiner Kollegin Herlinde Pauer-Studer ein Advanced Grant zuerkannt. Das ist natürlich ein schöner Erfolg für unser Institut, wenngleich man natürlich die Anzahl der ERC Grants nicht wirklich als Maßstab für die Qualität von Instituten verwenden kann. Oxford ist uns z.B. um Längen voraus, auch wenn die dort keine ERC Advanced Grants haben. Wie auch immer: ich bin froh, dass ich jetzt für einige Jahre hinsichtlich der Finanzierung meiner Mitarbeiter von Forschungsfonds FWF und der Akademie der Wissenschaften unabhängig bin.
STANDARD: Wie meinen Sie das?
Kusch: Ich habe in den letzten Jahren bei der Beantragung von Projekten und Forschungsstipendien bei diesen hiesigen Institutionen zum Teil recht schlechte Erfahrungen gemacht. Die Art und Weise, wie den Projekten Gutachter zugeteilt wurden und vor allem die Qualität der Gutachten haben mich mitunter doch sehr enttäuscht. Aber das ist ein weites Feld. (Klaus Taschwer, DER STANDARD, 23.4.2014)