Einmal im Jahr versuchen sich US-Präsidenten an der Kunst der Selbstironie. Beim White House Correspondents' Dinner witzeln sie vor der versammelten Presse in Washington über sich selbst, über Parteifreunde und politische Gegner. Wer zur Zielscheibe des gepflegten Spotts wird, sollte am besten mitlachen. Im April 2011 war es Donald Trump, der aufs Korn genommen wurde – von Barack Obama, dem Präsidenten, dem Trump unterstellte, nicht auf amerikanischem Boden geboren zu sein und damit gar nicht im Oval Office sitzen zu dürfen.
Drei Tage zuvor hatte Obama auch den letzten Zweifel ausgeräumt, indem er seine Geburtsurkunde, ausgestellt in Honolulu, öffentlich machte. Er wisse ja, zog er Trump auf, dass niemand glücklicher sei als "The Donald", dass die Sache mit der Geburtsurkunde nun endlich erledigt sei. Denn nun könne sich Donald endlich den wichtigen Fragen des Lebens zuwenden. "Haben wir die Mondlandung gefälscht? Und was geschah wirklich in Roswell?", fragte Obama und meinte eine Kleinstadt in der Wüste New Mexicos, in deren Nähe 1947 ein Ufo abgestürzt sein soll. "Donald würde ganz sicher den Wandel ins Weiße Haus bringen", stichelte er und ließ die Fassade seines Amtssitzes einblenden. Sie war versehen mit einer grellen Leuchtreklame, wie sie eher nach Las Vegas passen würde, und darunter stand: Hotel – Casino – Golfplatz.
Mit versteinerter Miene
Statt wenigstens so zu tun, als ließe er die Spitzen lächelnd über sich ergehen, saß Trump mit versteinerter Miene an seinem Tisch. An dem Abend, glaubt Roger Stone, ein langjähriger Berater des Immobilienmoguls, habe Trump beschlossen, sich eines Tages für die Präsidentschaft zu bewerben. An dem Abend habe er sich geschworen, dass er es allen zeigen werde – über Trump macht man sich nicht ungestraft lustig.
Als er vor knapp anderthalb Jahren tatsächlich seinen Hut in den Ring warf, war das Gelächter groß. Das Satiremagazin "The Onion" empfahl ihm den Wahlkampfslogan: "Ich mache das von nun an alle vier Jahre, bis ich sterbe."

Alle, Humoristen wie Experten, haben sich geirrt. Im Vorwahlmarathon der Republikaner setzte sich der Außenseiter gegen 16 Mitbewerber durch. Er besiegte den anfänglichen Favoriten Jeb Bush ebenso wie den aufstrebenden Marco Rubio. Die Erfahrung eines Berufspolitikers war nicht das, womit man sich aus der Sicht der vornehmlich weißen Wutbürger fürs Oval Office qualifizierte. Sie wollten einen Antipolitiker, einen Rebellen, der sich um politische Korrektheit nicht schert.
Trump hat Menschen Hoffnung gemacht, die sich als Verlierer der Globalisierung und des demografischen Wandels sehen. Ihm, dem Milliardär aus New York, ist es gelungen, zum Sprecher derer zu werden, die sich abgehängt fühlen; verraten und vergessen von den Etablierten, seien es Demokraten oder Republikaner.
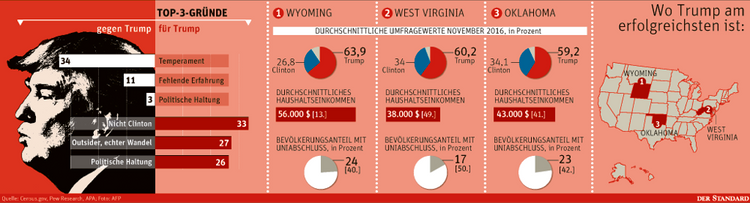
Er trat auf wie ein Entertainer, dem egal ist, wie stark er die Wirklichkeit verzerrt. Hauptsache, er findet Gehör. Tony Schwartz, der 1987 als Ghostwriter des Bauunternehmers den Bestseller "The Art of the Deal" schrieb, erfand den Begriff der "wahrheitsgemäßen Übertreibung", um Trumps zwanghaften Hang zum Lügen hinter einem "akzeptablen Gesicht" zu verbergen. Der Mann habe ohne jede Gewissensbisse gelogen, sagte Schwartz vor wenigen Monaten in einem Gespräch mit dem New Yorker. Habe man ihn damit konfrontiert, habe er nachgelegt und sei aggressiv geworden.
"Du bist gefeuert!"
Spricht man mit Trumps Anhängern in der Provinz, ist oft zu hören, dass er ihnen trotz seines glamourösen Lebensstils an der teuersten Straße Manhattans durchaus vertraut sei: nämlich aus "The Apprentice". In dieser Reality-TV-Show von 2004 stellte der Tycoon geeignete Kandidaten ein, während er anderen mit einem resoluten "Du bist gefeuert!" den Stuhl vor die Tür setzte. Es gibt Leute, die in dieser Sendung eine Art Probelauf für die Bewerbung fürs Weiße Haus sehen. Perfekt gekleidet, thronte Trump auf einem Stuhl mit hoher Lehne, ringsum holzgetäfelte Wände – das ließ in den Augen seiner Verehrer an einen Präsidenten denken.
Nach Schwartz' Worten handelt Trump nach der Devise, dass man etwas nur oft genug wiederholen müsse, dann werde es das Publikum schon irgendwann glauben. Oft sind es Anspielungen, so wie 2011, als er den ersten afroamerikanischen US-Präsidenten de facto zu einem Fremden stempelte. Sollte Obama nicht in den USA geboren worden sein, wäre es einer der großen Skandale unserer Zeit, orakelte er bei Fox News, dem Haussender der Konservativen.
Bild nicht mehr verfügbar.
Sollte, wäre, hätte: Es ist die Masche des Populisten, Behauptungen aufzustellen, von denen er sich bei Bedarf wieder zurückziehen kann, die aber in der Zwischenzeit ihre flüsterpropagandistische Wirkung entfalten. Es ist dieselbe Masche, nach der Trump im Kampagnenfinale andeutet, wer Hillary Clinton wähle, vergeude seine Stimme; der wähle eine Politikerin, gegen die wegen der E-Mail-Affäre bald Anklage erhoben werden könnte.
Bei zahllosen Kundgebungen hat das beharrliche Wiederholen von Unsinn funktioniert. Trump brauchte nur einen Satz zu beginnen, und die Menge brachte den Gedanken zu Ende wie ein Chor, der einem Solisten antwortet. "Mexiko! Mexiko!", ruft der Chor, wenn der Solist fragt, wer für den Bau einer Mauer an der Grenze bezahlen werde. "Sperrt sie ein! Sperrt sie ein!", erwidert der Chor, wenn Trump sagt, Clinton sei so korrupt und kriminell.
Deutliche Worte auch in zurückhaltenden Medien
Tief sitzt der Schock, den der Erfolg des Demagogen im liberalen Teil der US-Gesellschaft ausgelöst hat. Selbst Zeitschriften, deren Ton normalerweise zurückhaltend ist, haben überaus deutliche Worte gefunden. Der Kandidat, schrieb die hochseriöse Zeitschrift "The Atlantic" in einem Leitartikel, sei eine Krämerseele, die Verschwörungstheorien und Rassismus verbreite; ein erbärmlicher Sexist, sprunghaft, fremdenfeindlich; ein Bewunderer autoritärer Herrscher, leicht reizbar; ein Feind des faktenbasierten Diskurses, dem die Verfassung gleichgültig sei und der nicht zu lesen scheine. Erst zum dritten Mal seit seiner Gründung vor 159 Jahren hat das Magazin seinen Lesern eine Empfehlung gegeben, wen sie nicht wählen sollten. Das erste Mal, 1860, stand das Land vor einem Bürgerkrieg. Das zweite Mal, 1964, hieß der republikanische Präsidentschaftsanwärter Barry Goldwater – auch er ein Populist, verglichen mit Trump aber fast schon ein Waisenknabe.
Donald J. Trump, warnte das Blatt, sei vielleicht der unqualifizierteste Kandidat, den eine große Partei jemals ins Rennen ums Weiße Haus geschickt habe. Die Fans des 70-Jährigen hat es nicht interessiert: Für sie war es nur ein Beleg mehr für die Ratlosigkeit des Establishments. (Frank Herrmann aus Washington, 9.11.2016)