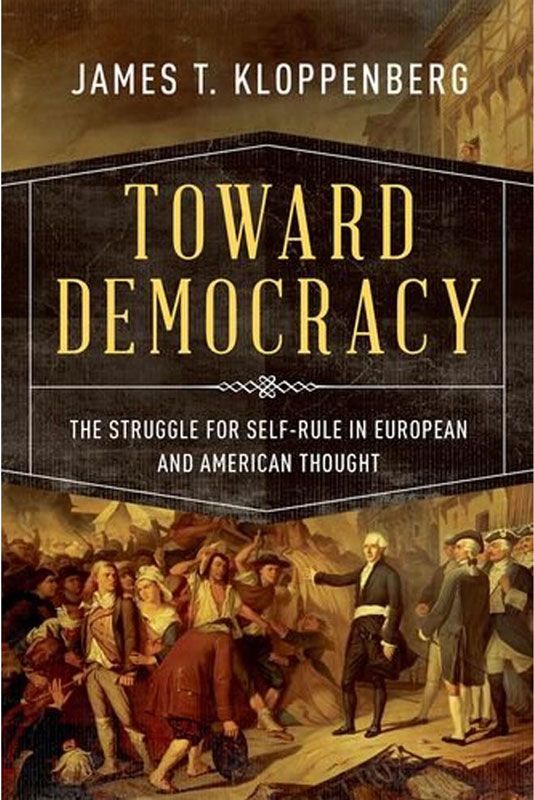STANDARD: In Ihrem Buch "Toward Democracy" haben Sie demokratische Entwicklungen in Frankreich, England und den USA in den vergangenen 300 Jahren analysiert – welche Charakteristika von Demokratien sind Ihnen begegnet?
Kloppenberg: Es bedarf spezieller Institutionen wie einer verfassungsmäßigen Regierung, die die Rolle der Gesetze sicherstellt. Doch das Hauptargument meines Buches ist, dass es neben diesen Institutionen bestimmte Voraussetzungen von Demokratie gibt, denen die Menschen oft nicht so viel Aufmerksamkeit beimessen, wie sie sollten. Dazu zählt das Prinzip der Volkssouveränität, das besagt, dass die Autorität dem Volk zukommt. Weiters die Verpflichtung zu Freiheit und Gleichheit. Das ist entscheidend, denn wenn es nur Mehrheitsentscheidungen gebe, können bei drei Leuten zwei beschließen, den Dritten zu versklaven. Daher bedingen sich die Verpflichtung zu Freiheit und jene zu Gleichheit gegenseitig, das eine bedarf des anderen.
STANDARD: Welche Voraussetzungen von Demokratie stehen aktuell speziell unter Druck?
Kloppenberg: Das Commitment zu Überlegungen, dass die Leute zusammenkommen und Fragen diskutieren, steht derzeit besonders unter Druck – auch in Anbetracht der Polarisierung der Politik in Europa und der USA im 21. Jahrhundert. Es gibt viele Leute, die meinen, dass Demokratie bedeutet, die eigene Position zu vertreten und sich weigern, einen Kompromiss zu finden. Doch Demokratie hat immer Kompromisse bedurft. Eine Demokratie kann nicht immer das bringen, was man selbst will. Eine weitere Voraussetzung, die aktuell besonders unter Druck steht – das gilt auch für Österreich -, ist Pluralismus und Differenzen zu akzeptieren. Die Menschen sind immer unwilliger, andere Menschen, die nicht wie sie selbst sind, zu akzeptieren.
STANDARD: Konnten Sie in Ihrer Langzeitanalyse eine Entwicklung des Demokratiebegriffs feststellen?
Kloppenberg: Ja, zum Beispiel haben wir heute ein vollkommen anderes Verständnis davon, wer Bürger ist. Keine der Nationen, die vor 300 Jahren mit Demokratie experimentierten, war gewillt, das Bürgerrecht auf Frauen auszuweiten. Man ging davon aus, dass Frauen durch ihre Männer abgedeckt werden. Eine ähnliche Veränderung war die Erweiterung der Rechte für farbige Menschen, die davon im 18. Jahrhundert ebenso ausgeschlossen waren. Im 20. Jahrhundert hat sich die Demokratie weiters von der politischen in die soziale und wirtschaftliche Sphäre ausgeweitet. In Europa ist die Demokratie heute viel mehr entwickelt als in den USA, das merkt man etwa, wenn man die Krankenversicherungen vergleicht.
STANDARD: Können Sie aus der historischen Perspektive Vorhersagen ableiten, wie sich die Demokratie künftig entwickeln wird?
Kloppenberg: Als Historiker fühle ich mich dabei sehr unwohl. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt fast unmöglich, hoffnungsvoll über die Tendenzen in Europa wie auch in den Vereinigten Staaten zu sein. Die Wählerschaft ist da wie dort tief gespalten. Es scheint aber breite Unterstützung dafür zu geben, die Rechte von Immigranten einzuschränken und den großzügigen sozialen Wohlfahrtsstaat zurückzufahren. Wir sind im Moment an einen Punkt einer instabilen Balance geraten.
STANDARD: Was sind Gründe dafür?
Kloppenberg: Die Politik wird von Ängsten angetrieben. Europa steht unter einem großen Druck durch die große Anzahl an Immigranten. Die Vereinigten Staaten sind durch die unverhältnismäßige Angst vor dem Terrorismus unter Druck geraten. Man sollte bedenken, dass die Wahrscheinlichkeit viel größer ist, vom Blitzschlag getroffen zu werden, als von einem Terroristen getötet zu werden. Dennoch fürchten sich die Menschen extrem vor Terrorismus, und diese Angst scheint einen Großteil der amerikanischen Politik anzutreiben. Diese Ängste sind nicht völlig bodenlos, ich glaube nur, dass sie aus dem Lot geraten sind, gemessen an der tatsächlichen Bedrohung.
STANDARD: Welchen Einfluss könnte der neue US-Präsident auf die Entwicklung der Demokratie in den Vereinigten Staaten haben?
Kloppenberg: Die Resilienz von Demokratien wird an diesem Punkt getestet. Die Reaktion der amerikanischen Bevölkerung auf Donald Trump, auch die Reaktion der europäischen Bevölkerung auf die rechten Demagogen, die in den vergangenen Jahren aufgetreten sind, werden entscheiden, ob diese Demokratien stabil bleiben, oder ob wir eine Periode der Unruhe erleben werden. Trump hat während seiner Kampagne klar gemacht, dass er kein klares Verständnis von der Verfassung der Vereinigten Staaten hat. Was ich aber gerne dazu sagen will, ist, dass die Verfassung ein gutes Verständnis von ihm hat. Egal, wie weitreichend die Absichten eines Präsidenten sind, es gibt Grenzen, was er tatsächlich tun kann. Ich kann auf die Frage nach der Zukunft nur mit dem Titel Ihrer Schwerpunktausgabe antworten: Die Demokratie ist gegenwärtig unter Druck.
STANDARD: Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass Demokratie zum weltweiten Ideal des Regierens aufgestiegen ist – warum gibt es dennoch immer wieder Rufe nach einem starken Mann?
Kloppenberg: Um das zu beantworten, müsste man sich wohl China oder den Mittleren Osten ansehen. Dort scheint es wenig Interesse an Demokratie zu geben und es sieht nicht so aus, dass sich das in der nächsten Zeit ändern wird. Aber im Westen ist der starke Mann, nach dem Leute rufen, einer, der demokratisch gewählt wird. Und wenn so ein starker Mann an der Macht bleiben will, muss er eine Wiederwahl gewinnen. Es gibt also gute Gründe, anzuzweifeln, dass ein demokratisches System so einfach außer Kraft gesetzt werden könnte. Das bekannteste Beispiel, wo das passiert ist, war Adolf Hitler. Ich denke aber, dass die Menschen nun viel alarmierter sind, die demokratischen Institutionen sind jetzt besser verankert und stabiler als sie es in den 1930er-Jahren waren.
STANDARD: Ist der Neoliberalismus eine Gefahr für Demokratie?
Kloppenberg: Ich denke, dass Demokratien Werkzeuge haben, den Markt unter Kontrolle zu bringen. Es bedarf nur der Bereitschaft der Menschen. Und das ist so frustrierend für linke Intellektuelle in den Vereinigten Staaten. Es gibt nichts Strukturelles, das die Leute davon abhält, Politiker zu wählen, die nicht zulassen, dass alle wichtigen Entscheidungen vom Markt getroffen werden. Es ist einfach nur eine Frage des politischen Willens. Der Neoliberalismus hat es geschafft, ein Klima zu schaffen, wo man immer davon ausgeht, dass die Regierung das Problem ist, und alle Probleme gelöst würden, könnte nur der freie Markt entscheiden. Aber die Menschen könnten auch Politiker wählen, die dem widersprechen. In den Vereinigten Staaten gibt es derzeit eine kulturelle Unruhe, die viele Leute spüren, weil sie meinen, dass ihre Nation von Menschen überrannt wird, die anders sind als sie. Diese kulturelle Unruhe hat zur Bereitschaft geführt, Marktkräften mehr zu vertrauen als der Regierung. Es gibt aber keinen offensichtlichen Grund dafür.
STANDARD: Was kann getan werden, um der Demokratie aus der Krise zu helfen?
Kloppenberg: Demokratie bedarf der Einsicht, dass der Gegner recht haben kann und man selbst unrecht hat. Dass das Gegenüber gewinnen kann und man selbst verlieren. Im Laufe der Geschichte hat sich gezeigt, dass das eine Art des Denkens ist, mit der sich viele Menschen nicht anfreunden konnten. Es obliegt jenen, die sich demokratischen Grundsätzen verpflichtet fühlen, zu erklären, warum wir denken, dass sie besser sind als die Alternativen. (Tanja Traxler, 21.1.2017)