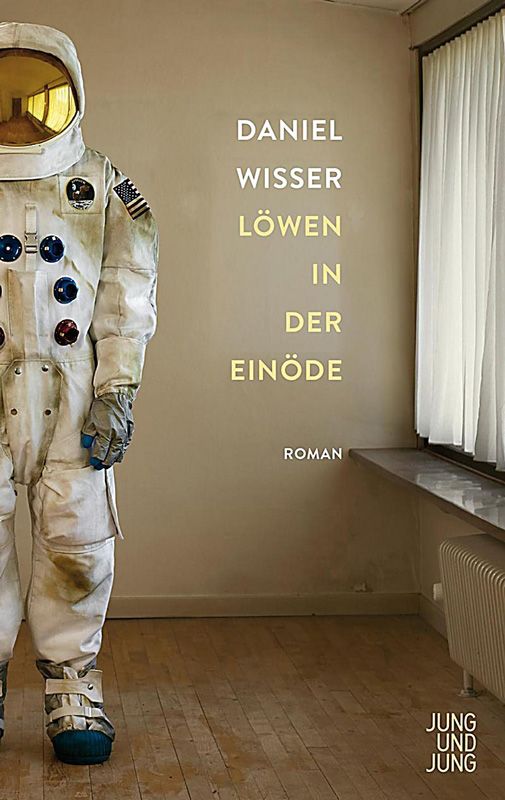Montag, 13. Februar 2017
Gestern habe ich die Zeitung gekauft und mich in die Konditorei Aida gesetzt, in jene Filiale gegenüber dem Arne-Carlsson-Park, in der man früher Vortagskrapfen kaufen konnte. Ich bestelle, gehe aufs WC, und als ich zurückkomme, sitzt eine junge Frau an meinem Tisch. Es ist Kinga, Kinga Tóth, die Tochter des Komponisten László Tóth. Wir waren von 1989 bis 1990 Studienkollegen und beste Freunde, bis wir uns im Café Bendl wegen des Irakkriegs zerstritten haben. Sie grüßt mich freundlich und küsst mich auf beide Wangen. Als sie die Titelseite der Zeitung sieht, schaut Kinga gleich wieder weg: Vor Start der Bodenoffensive bat Gorbatschow um Aufschub. Ich schaue trotzdem auf die Titelseite, um das Datum zu sehen: Montag, 18. Februar 1991. Was hast du bestellt?, fragt Kinga. Wie immer, sage ich, Kakao ohne Schlag, Vortagskrapfen. Wir schauen uns nicht in die Augen. Du hast dich nicht verändert, sage ich. Du redest so, als hätten wir uns seit 20 Jahren nicht mehr gesehen, sagt Kinga. Ich höre Kinga gerne reden, besonders wenn sie das Wort einzigartig sagt. Es ist so wenig ei in diesem einzigartig, dass ich immer endsiegartig verstehe. Kinga sagt Sätze wie: Die Dummheit dieser Rechtspolitiker ist wirklich endsiegartig. Heute aber sagt sie: Ich gehe zu meinem Vater. Kommst du mit? Wir verlassen die Aida. Doch als ich vor der Tür stehe, ist Kinga weg. Ich blicke auf die Zeitung: Montag, 13. Februar 2017. Keine Rede vom Irakkrieg.
Mittwoch, 15. Februar 2017
Ich weiß schon, warum Kinga Tóth sich nicht verändert hat. Weil sich nichts verändert hat. Sie sieht aus wie früher, weil es früher ist. Das Datum auf der Titelseite der Zeitung bestätigt es: Montag, 18. Februar 1991. Die Zeit hat sich verändert, als Kinga durch die Tür der Konditorei Aida gekommen ist, aber Kinga hat sich nicht verändert. Von allen Menschen, die ich beim Studium kennengelernt hatte, war mir Kinga der Liebste. Warum wir uns damals gestritten haben, weiß ich nicht mehr. Und ausgerechnet im Café Bendl, unserem Lieblingslokal. Wir liebten das Café, das Bier, die alte Kellnerin, die die Speisekarte als Dreizeiler aufsagen konnte (kürzer als ein Haiku): Wurstbrot, Speckbrot, Speck mit Ei. Und wir liebten die Jukebox, besonders die Single Heart of Glass von Blondie. Zum einen, weil im Refrain ein Takt um einen Schlag verkürzt war und die Dancing Fools und Mitwippenden durcheinanderbrachte. Zum anderen, weil wir den Songtext einfach nicht verstanden:
Once I had a love, and it was a gas.
Soon found out, I had a heart of glass.
Kinga betrachtet die Schlagzeile: Moskau und Washington geben Iraks Außenminister noch eine letzte Chance. Bist du noch immer für Saddam?, fragt sie. Ich muss lachen: Ich war nie für Saddam.
Heute willige ich ein, Kingas Vater zu besuchen, obwohl ich dabei ein wenig Angst habe. Wir verlassen die Aida und gehen die Währinger Straße entlang. Die Zeitung steckst du besser ein, sagt Kinga. Du weißt, mein Vater mag keine Zeitungen. Und nun folgt eine Reihe von Anweisungen oder besser Verboten, was ich alles nicht tun darf, wenn wir bei ihrem Vater sind. Stell deine Schuhe im Vorzimmer nicht genau parallel ab, denn sonst beginnt der Vater sofort über Schönberg zu reden. Berühre den Flügel im Salon nicht, und schau ihn dir auch nicht zu genau an. Sag ja nicht, dass du rauchst. Erwähne Rauchen überhaupt nicht. Sag nichts, das mit Ungarn zu tun hat, sprich den Namen Mozart nicht aus, und sag niemals das Wort Geologenhammer. Warum lachst du?, fragt Kinga. Es fällt mir wirklich schwer, im täglichen Leben ohne das Wort Geologenhammer auszukommen, sage ich. Als wir an der Ecke Sensengasse an der Fußgängerampel warten, will ich mich zu Kinga drehen. Doch sie ist plötzlich gasförmig. Ich hatte einst eine Liebe und sie war ein Gas.
Freitag, 17. Februar 2017
Auch gestern habe ich mich in die Konditorei Aida gesetzt. Ich gehe gerne aufs WC. Lieber aber komme ich zurück vom WC. Kinga ist mir nun wieder vertraut. Sie gibt mir zwei Küsschen und ignoriert die Zeitung. Dabei gibt es eine Nachricht über Ungarn: 4-Jahres-Roßkur für die Ungarn auf Seite 14. Auf dem Weg in die Lackierergasse sagt Kinga mir, was alles verboten ist. Ich wiederhole: die Schuhe nicht parallel hinstellen, kein Mozart, kein Ungarn, keine Flügel-Berührung. Und kein Geologenhammer.
Als wir ankommen, sitzt László Tóth schon mit einem Gast im Salon. Er kümmert sich zuerst nicht um Kinga und mich. Erst nachdem wir uns gesetzt haben, stellt er uns den Musikwissenschafter Stephan Protschka vor. Ich kenne Protschkas Radiosendungen. Kinga sagt, Protschka ist ein Quatschkopf, ein Schönling und Grinsekater, der die Anekdoten, die er über Beethoven erzählt, mit Musikwissenschaft verwechselt. Aber an diesem Tag quatscht der Quatschkopf nicht, sondern hört zu. Eine alte Frau kommt mit einem Servierwagen. Darauf Tee, Kekse und Erdnüsse. Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, Erdnüsse zu essen. Bevor ich etwas tue, schaue ich Kinga an. Nimmt sie einen Keks, nehme ich auch einen Keks.
Ich kam natürlich 1956 hierher, sagt László Tóth. Gleich am zweiten Tag bin ich ins Ministerium gegangen und habe mich vorgestellt. Ich dachte, ein Komponist meldet sich bei der Regierung und bekommt Aufträge. Ich war sehr enttäuscht, dass ich nicht gleich an Ordnungsstelle einen Kompositionsauftrag bekommen habe. Tóth sagte an Ordnungsstelle. Aber er meinte an Ort und Stelle. Ich muss lächeln. Dabei fällt mir eine Erdnuss aus der Hand und landet auf dem Sofa. Man kümmerte sich nicht um meine Musik, sondern behandelte mich wie einen normalen Ungarn-Flüchtling, erzählt Tóth. Erst viel später wurde ich überhaupt wahrgenommen, und schließlich wurde im Juni 1972 eines meiner Stücke im Musikverein aufgeführt.
Inzwischen allerdings war ein anderer Tóth László weltberühmt geworden: ein aus Ungarn stammender australischer Geologe. Bei diesem Wort räuspere ich mich. Protschka dreht sich zu mir und nickt mir zu. Ich erwarte, dass Kinga mir heimlich auf den Fuß tritt. Aber es passiert nichts.
Tóth László betrat am 21. Mai 1972 den Petersdom, sagt László Tóth, stürmte auf die Pietà zu und schlug auf Michelangelos Statue ein, bis andere Besucher des Doms ihn zu Boden rissen. Ich bin Jesus Christus, auferstanden von den Toten, soll er dabei gerufen haben. Er selbst hieß Tóth und glaubte, er sei von den Toten auferstanden. László Tóth wartet, ob jemand über seinen Witz lacht. Kinga lacht nicht. Also lache ich auch nicht. Nur Stephan Protschka grinst. Aber er grinst immer.
Tóth László schlug auf die Statue ein. Mit einem Geologenhammer. Mit fünfzehn Schlägen beschädigte Tóth László den linken Arm, die Nase und das Auge der Madonna. Und den Schleier über ihrem Haar auch, glaube ich, sagt László Tóth. Mit einem Geologenhammer. Totenstille im Salon. Für einen Moment bewegt sich niemand. Keiner wagt es, aufzublicken. Auch ich bewege mich nicht und schaue auf den Tee in meiner Tasse. Ich warte, bis etwas passiert. Irgendwann nimmt Stephan Protschka die Teekanne und gießt László Tóth Tee nach. Der junge Mann mit den guten Manieren macht immer alles richtig.
Ich hasse die katholische Kirche, sagt László Tóth. Also nahm ich die Nachricht von der Attacke auf die Pietà zuerst mit Schmunzeln auf. Dann kam die Uraufführung meines Werkes im Musikverein. Am Ende des Stücks ging ich auf die Bühne und verbeugte mich mit den Musikern. Danach ging ich in die Garderobe. Vor der Garderobe warteten sechs oder sieben ältere Herrschaften. Ich dachte, sie wollten Autogramme, aber plötzlich nahmen sie ihre Regenschirme zur Hand und schlugen damit auf mich ein. Du warst das, du Hund, riefen sie dabei. László Tóth wiederholt immer wieder: Du warst das, du Hund!
Am Abend, als ich aufbreche, sagt Kinga zu ihrem Vater, dass sie mich noch zur Straßenbahn begleitet. Ich gehe zu Fuß, sage ich zu Kinga. Kinga umarmt mich. Erst dann kommen die Küsschen auf die Wangen. Also, sagt Kinga, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Wurstbrot, Speckbrot, Speck mit Ei, antworte ich. (Daniel Wisser, Album, 18.2.2017)