STANDARD: Waren Sie überrascht, als 2013 der Versuch Ihrer damaligen Postdoktorandin Madeline Lancaster glückte, ein Gehirnorganoid zu entwickeln?
Knoblich: Man muss ehrlicherweise sagen: Das war schon einer dieser Glücksmomente, wo einfach viel zusammengepasst hat. Da wir gewöhnt waren, mit der Fruchtfliege zu arbeiten, sind wir naiv an die Sache herangegangen. Wir kannten übliche Ansätze nicht, haben nicht genau nachgelesen, was in der Richtung schon gemacht worden war – und haben es anders versucht, weshalb es wohl auch besser funktionierte.

STANDARD: Wie reagieren Sie auf eventuelle Sorgen der Öffentlichkeit, hier könnte eine Art menschlicher Bioreaktor laufen?
Knoblich: Ich finde es schade, wenn in unserem Kulturkreis, in Deutschland übrigens genauso wie in Österreich, zuerst an die potenziellen Probleme gedacht wird. Das ist die Reaktion, wenn jemand etwas vollkommen Neues macht. Wenn man so über das Auto als Erfindung denken würde, dann hätte man es schon längst verbieten müssen. Jedes Jahr sterben tausende Menschen im Straßenverkehr. Man muss zuerst einmal sehen, welche einmaligen Chancen wir damit haben. Wir können Krankheiten auf molekularbiologischer Basis studieren und damit auch besser verstehen – womit diese Arbeit eine hohe gesellschaftliche Relevanz hat. Ich habe mich aber auf die Interaktionen mit der Öffentlichkeit und den Medien vorbereitet, versuche, Befürchtungen ernst zu nehmen, zu verstehen und auszuräumen. Ein bisschen bin ich stolz, dass von den gut tausend Berichten über unsere Arbeit damals nur ein einziger negativ war.
STANDARD: Warum ist diese von Ihnen beschriebene Skepsis ausgerechnet in Deutschland und Österreich so stark ausgeprägt?
Knoblich: Wahrscheinlich ist in den Kulturen beider Länder eine Skepsis gegenüber Versprechungen tief verwurzelt. Es hat mit einer Angst vor Genetik, vor Menschenoptimierungen zu tun. Jedes Weltuntergangsszenario, Fantasien, wir würden Gehirne bauen, die dann autonom Entscheidungen treffen, würde ich aber entschieden zurückweisen, weil wir mit den Hirnorganoiden weder irgendetwas versprechen noch Menschen optimieren wollen. Das dient ausschließlich der Forschung – um zum Beispiel die molekularbiologischen Vorgänge hinter der Epilepsie besser zu verstehen. So konnte man diese Erkrankung noch nie studieren. Ich muss auch sagen: Selbst wenn es Wissenschafter gäbe, die damit Allmachtsfantasien verfolgen, was ich so gut wie ausschließen möchte: Jedes Experiment dieser Art muss nach strengen Richtlinien vorbereitet und durchgeführt werden. Man braucht die Zustimmung von Patienten, die Zellen für die Forschung spenden, man muss es ihnen erklären, und man muss es ihnen gut erklären. Das kontrolliert eine Ethikkommission, die nicht nur aus Wissenschaftern, sondern auch aus Theologen und Laien besteht.
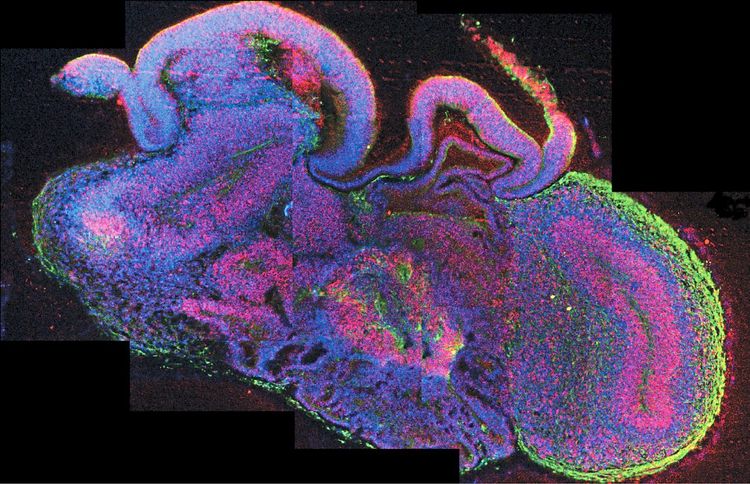
STANDARD: Ist Österreich ein besonderer Fall von Zukunftsvergessenheit?
Knoblich: Es ist schon so, dass die Wissenschaft hierzulande, solange sie kein Geld bringt, nicht unbedingt oben auf der Agenda steht – das halte ich für problematisch. Der Trend ist auch in den USA, in Frankreich und England spürbar. Überall wird gekürzt. Hier wird noch nicht gekürzt, aber im Vergleich zu den Anforderungen viel zu wenig erhöht. Man denkt kurzfristiger und versteht manches einfach nicht. Wenn man es global betrachtet, nimmt die Politik die Wissenschaft nicht so wichtig, aber zum Glück gibt es Wissenschafter, die den Mund aufmachen. Und zum Glück gibt es Schüler. Die sind sehr positiv gegenüber der Wissenschaft eingestellt und wollen genau wissen, wie man die Welt vielleicht ein Stück weit besser machen kann.
STANDARD: Ist die Öffentlichkeit mit der Schnelligkeit der Technologieentwicklungen überfordert, oder wird es ihr nicht gut erklärt?
Knoblich: In der Öffentlichkeit besteht große Angst vor der ferneren Zukunft. Es gibt ja Technologien wie CRISPR/Cas9, die wir in den Organoiden verwenden, um Gene aus- oder einzuschalten. CRISPR ermöglicht Dinge sehr schnell und effizient, die wir jetzt ethisch noch nicht bewerten können. Wenn es gelänge, Menschen genetisch zu verändern, wäre das schon ein Dammbruch. Das machen wir hier am Institut nicht, haben es auch sicher nicht vor. Ich glaube auch nicht, dass das in den nächsten zehn Jahren passieren wird. Aber es könnte in ferner Zukunft passieren, und da muss man sich jetzt Gedanken machen. Eine Diskussion darüber ist also gut und nützlich. Von der deutschen Akademie der Wissenschaften gab es Richtlinien, in den USA hat die National Academy Richtlinien veröffentlicht, die Wissenschaftern ein Rahmenwerk zur Verfügung stellen, wodurch sie sehen können, was die Gesellschaft toleriert.
STANDARD: Was sind die ethischen Probleme bei CRISPR/ Cas9?
Knoblich: Die zentrale Frage ist, ob und, wenn ja, wie man Lebewesen genetisch verändern kann. Es ist durch CRISPR möglich, dass wirklich alle Nachkommen dieser Lebewesen diese Veränderungen in sich tragen. Das nennt man Gene-Drive. Technisch ist das möglich, wird auch unter enormen Sicherheitsvorkehrungen versuchsweise gemacht, die Frage ist, ob man das will – und welche Folgen das auf das Ökosystem haben kann. Ein Beispiel: Wir würden niemals alle Gelsen so verändern, dass sie uns nicht mehr stechen. Da wäre uns das Umweltrisiko zu groß. Würden wir aber in einem Land leben, in dem jedes Jahr tausend Kinder an Malaria sterben, würden wir vielleicht anders darüber denken. Das kann kein Staat für sich allein regeln, da braucht man Regeln für die ganze Welt. Und damit ist noch nicht einmal die größte bioethische Frage aufgeworfen: Darf man mit CRISPR in das menschliche Erbgut eingreifen?
STANDARD: Wie denken Sie darüber?
Knoblich: Ich sehe kurzfristig keine Notwendigkeit dafür. Es gibt Erbkrankheiten, die man nur so behandeln könnte, es sind aber sehr wenige – und wir sind uns derzeit über potenzielle Nebenwirkungen und die gleichzeitig möglichen schädlichen Mutationen nicht im Klaren. Wenn wir aber an die Welt in 50 Jahren denken, dann ist das anders. Dann möchte ich meine Kritik an der zentraleuropäischen Einstellung, besser alles so zu belassen, wie es ist, wiederholen: Diese Einstellung ist falsch, denn die Menschheit, die Erde verändern sich. Die Bevölkerung wächst, gleichzeitig ist die Zahl der Kinder in den vergangenen zehn Jahren konstant geblieben. Die Gesellschaft wird älter. Man weiß, dass Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson im Jahr 2050 so viel kosten, dass sie jedes Gesundheitssystem kaputtmachen werden. Wir brauchen für die Probleme, die auf uns zukommen, vielleicht einmal bahnbrechende Lösungen.Ich lehne heute die genetische Veränderung eines Menschen ab, aber ich könnte mir vorstellen, dass meine Enkel einmal anders denken werden.
STANDARD: Gibt es auch relevante ethische Bedenken beim Thema Organzüchtung?
Knoblich: Organzüchtungen, wie wir sie für Forschungszwecke im Ansatz testen, sind ethisch selbstverständlich anders zu bewerten als CRISPR. Wenn wir irgendwann einmal dazu in der Lage sind, fertige Nieren im Labor zu züchten, dann wäre das ein riesengroßer Durchbruch. Das wäre ganz fantastisch für viele Leute, die dringend auf ein Spenderorgan warten und dabei verzweifeln. Komplette Organe im Labor zu machen ist ja noch nicht möglich. Nur für die Haut geht das. Eine Leber oder eine Niere ist zu komplex in der Dreidimensionalität, da sind die Wissenschafter noch ein großes Stück entfernt. Es werden oft auf einer anderen Ebene Dinge miteinander verknüpft, die nicht zusammengehören. Das Wirtschaftsgebaren von Firmen wie Monsanto, die sicherlich Dinge gemacht haben, die moralisch nicht in Ordnung waren, wird mit der von der Firma angewandten Technologie vermischt. Man muss Regeln aufstellen für derartige Unternehmen. Man kann ihnen verbieten, Bauern in ein Abhängigkeitsverhältnis zu bringen. Leider könnte eine solche Vermischung wieder passieren. Die Leute könnten sagen: Keine Organe aus Stammzellen, da verdienen nur die Pharmafirmen. Und deswegen wollen wir kein funktionsfähiges Organ, das wir zum Überleben brauchen? Die Pharmafirmen brauchen Regeln, stimmt. Aber deswegen sollte man die Technologie nicht verteufeln.
STANDARD: Die Nutzung embryonaler Stammzellen ist strengen Gesetzen unterworfen. Können Sie das als Wissenschafter gut nachvollziehen?
Knoblich: Natürlich. In hauptsächlich katholischen Ländern wie Österreich habe ich dafür auch großes Verständnis. Wir müssen die Stammzellen daher einführen, hier selbst dürfen keine produziert werden. Ich glaube aber, dass die Diskussion relativ abgeflaut ist. Und die Einstellung der Menschen gegen die Nutzung von embryonalen Stammzellen wird vielleicht bald nicht mehr so streng sein. In Skandinavien und in den USA starten klinische Versuche mit embryonalen Stammzellen bei Parkinson-Patienten. In Japan macht man es mit induzierten pluripotenten Stammzellen, das sind Haut- und Blutzellen, die man in den Urzustand zurückführen kann. Wenn das klappt und die Menschen sehen, dass damit jene Nervenzellen erneuert werden können, die bei Parkinson zerstört werden, dann sollte sich doch einiges im Umgang mit der Frage ändern. Ich glaube nicht, dass man die Nutzung solcher Stammzellen für die Forschung dann noch ernsthaft ablehnen kann. Wenn man es dennoch macht, sollte man aber ehrlicherweise auch die Therapie im Krankheitsfall nicht anwenden. Es ist ja jedem freigestellt zu sagen: Nein, ich will mich nicht mit diesen Stammzellen behandeln lassen. (Peter Illetschko, 4.9.2017)