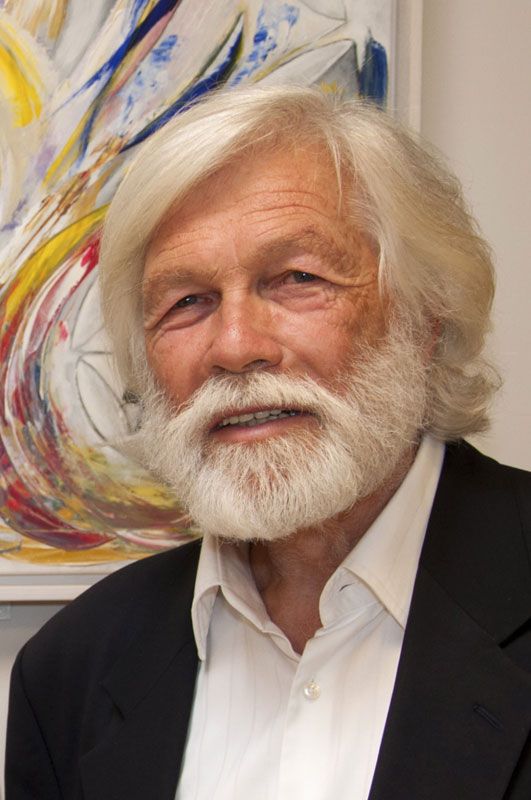STANDARD: Armin Wolf wurde mehrfach ausgezeichnet und wird doch stark kritisiert. Wie stehen Sie zur Causa?
Gottschlich: Ich bin ein Verteidiger und Anhänger dessen, was Armin Wolf macht. Es ist vollständig unverständlich, dass das eigene Haus ihn so im Regen stehenlässt. Wolfs politische Interviews zählen zum Besten, was der ORF, der ja stets seine Unabhängigkeit betont, journalistisch zu bieten hat.
STANDARD: Warum werden die Leistungen von Armin Wolf in Deutschland gelobt und in Österreich kaum gewürdigt?
Gottschlich: Im Unterschied zu Deutschland, oder auch zu England, gibt es im öffentlichen Diskurs hierzulande ein starkes Harmoniebedürfnis, ein hohes Maß an Autoritätsgläubigkeit in der Gesellschaft und eine ungesunde Nähe zwischen Politik und Journalismus. Das alles hemmt die Lebendigkeit einer kritischen Debattenkultur. Dazu kommt: Österreich hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Vertreibung und Ermordung der österreichischen Juden, die bis zur Machtübernahme der Nazis das kulturelle und mediale Leben prägten, von diesem intellektuellen Aderlass nicht wirklich mehr erholt. Daran leidet die politische Kultur in diesem Land bis heute.
STANDARD: Wie kann man dieses Problem der Nähe zwischen Medien und Politik lösen?
Gottschlich: Das ist zunächst eine Frage der moralischen und professionellen Haltung. Es ist dies aber auch eine Frage der strukturellen Bedingungen journalistischen Handelns. Wenn das größte Medium eines Landes, wie es der ORF ist, über seine beiden kontrollierenden Aufsichtsgremien Stiftungsrat und Publikumsrat direkt oder indirekt unter paritätisch ausgewogener parteipolitischer Aufsicht steht, dann steht kritischer, unbequemer Journalismus, wie der Fall Armin Wolf zeigt, wenn schon nicht unter Sanktionsandrohung, so doch zumindest unter ständigem Rechtfertigungsdruck. Ich glaube allerdings, dass sich dieses Problem ohnehin bald von selbst löst.
STANDARD: Warum?
Gottschlich: Weil die politischen Parteien über eigene Social-Media-Kanäle viel effektiver ihre Botschaften nach außen tragen können und wesentlich mehr – insbesondere junge Menschen – erreichen als über die klassischen Medien.
STANDARD: Ist das besser, wenn politische Botschaften ungefiltert im Netz landen?
Gottschlich: Die Frage stellt sich heute nicht mehr. Wir leben im Zeitalter der Totalinformation. Allen und jedem steht das Netz – und damit unendliche Verbreitungsmöglichkeiten – zur Verfügung. Das alte journalistische Rollenbild des "ehrlichen Maklers" zwischen einer Vielzahl unterschiedlicher gesellschaftlicher Kräfte bzw. Interessen und der Öffentlichkeit ist längst obsolet. Was wir heute vielmehr brauchen, ist ein neuer Typus von Journalisten, nämlich den "Wissens- und Informationsnavigator", der durch seine Orientierungsleistung dazu beiträgt, dass die Menschen in der rasant wachsenden Informationsflut nicht untergehen.
STANDARD: Damit der Leser zwischen Gut und Böse unterscheiden kann?
Gottschlich: Ja, das auch. Im Übrigen ist das die Funktion von Kritik insgesamt, auch von journalistischer Kritik, nämlich zur Unterscheidung zwischen wahr und falsch, gut und schlecht usw. beizutragen. Aber es geht auch darum, unsere komplexe Welt verstehbar zu machen. Wenn dieses Bedürfnis nach Weltverstehen nicht durch kompetenten, kritischen und die Mächtigen kontrollierenden Journalismus befriedigt wird, dann übernehmen mehr und mehr die Populisten diese Aufgabe, indem sie simple Scheinlösungen und eindimensionale Sichtweisen propagieren.
STANDARD: Gibt es Wege, wie sich Journalismus neu orientieren könnte?
Gottschlich: Inhalt muss wichtiger sein als Inszenierung. Mit Unterhaltungselementen Inhalte zu transportieren ist eine Gratwanderung. Zweitens reicht es nicht aus, Sachverhalte bloß zu beschreiben – sie müssen auch erklärt und in einen Kontext gesetzt werden, denn Fakten sprechen in den seltensten Fällen für sich. Drittens muss Journalismus differenzieren, statt zu polarisieren. Und: Journalisten brauchen nicht nur einen Wirklichkeitssinn, sondern auch, im Sinne Robert Musils, einen Möglichkeitssinn.
STANDARD: Was meinen Sie damit?
Gottschlich: Es gibt immer unendlich mehr Möglichkeiten, als gerade durch unsere Entscheidungen aktualisiert werden und die wir dann "Wirklichkeit" nennen. Dabei handelt es sich aber nicht um "die Wirklichkeit" an sich, sondern lediglich um Wirklichkeitsentwürfe, die unserer momentanen Sicht der Dinge entsprechen und die mit einem je eigenen Wahrheitsanspruch versehen sind. Warum sollen Medien und Journalismus den Wirklichkeitsentwürfen der Politik nicht auch andere, ebenso denkbare Möglichkeiten entgegensetzen? Journalisten brauchen also auch so etwas wie ein visionäres Potenzial.
STANDARD: Das heißt, Journalisten sollten mehr spekulieren?
Gottschlich: Ich würde es so sagen: Der moderne Journalismus hat eine dialogische Verantwortung, weil sich der Mensch der Wahrheit oder den Wahrheiten nur dialogisch annähern kann. Denn niemand kann von sich sagen, er sei schon im Besitz der Wahrheit. Wenn dies aber so ist, meinte schon der liberale Denker John Stuart Mill, dann sollten wir alles dazu tun, dass wir uns an der gemeinsamen Wahrheitssuche beteiligen können. Das geht nur auf dem Weg der Kommunikation, des Dialogs. Darin liegt ja auch die Grundidee der Presse- und Meinungsfreiheit. Um diese gemeinsame Wahrheitssuche geht es letztlich – und die bedarf in der Demokratie des Muts zur öffentlichen Kontroverse, der Bereitschaft zum nachbohrenden Widerspruch und zum hartnäckigen Hinterfragen.
STANDARD: Womit wir wieder am Anfang, bei Armin Wolf und kritischen Interviews sind.
Gottschlich: Ja, denn Demokratie lebt nicht vom Kuschelkurs, sondern vom Widerspruch. Wer im Journalismus bloß affirmative Interviews führen möchte, ist besser in der PR aufgehoben. In Zeiten der Perfektionierung der politischen Inszenierung brauchen wir aber nicht Journalisten, die als politische Stichwortgeber agieren, sondern Journalisten, die sich auf den begründeten Widerspruch einlassen, also – wie Armin Wolf – auch die seltene Kunst des kontroversiellen Interviews beherrschen. Das ist die eigentliche Domäne der Qualitätsmedien, und darin haben sie auch – allen Unkenrufen zum Trotz – Zukunft. (ehei, 7.7.2017)