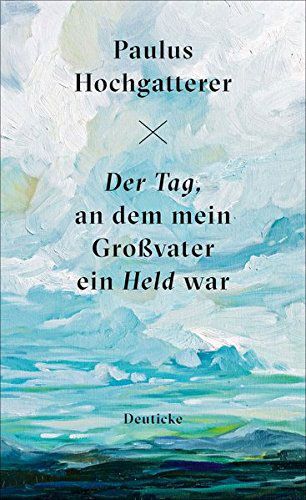Die Schwalben sind da. Manchmal verändert so etwas alles. Du stehst irgendwo, zum Beispiel vor dem Haus, und denkst nach oder betrachtest die Wolken wie an jedem Tag, und nach einer Weile merkst du, dass etwas anders ist. Du blickst erst den Horizont entlang, über die Hügel, die Dächer, die Baumkronen. Dann suchst du nach einem Pfeifen in der Luft, nach einem Brummen oder vielleicht nach einem Geruch. Am Ende schaust du nach, ob du dir unbemerkt in deine Kleider ein Loch gerissen hast, am Ärmel vielleicht, am Knie oder unter der Achsel. Du findest nichts. Plötzlich weißt du es: Es sind die Schwalben, die zurück sind.
Sonst ist heute alles wie gestern. Die jagenden Wolken, die Maulwurfshügel, die abgebrochenen Äste unter den Obstbäumen, der Kleiber, der vorne die Scheunenwand auf und ab läuft. Kleiber sind Glückstiere, sagt Laurenz, genau wie Kröten oder Igel oder Hirschkäfer. Elstern und Füchse bringen Unglück, sagt er. Die Schwalben stoßen herab wie Pfeile und ziehen schräge Schleifen zwischen Scheune und Stall. Es sind die mit den weißen Bäuchen und den V-Schwänzen, nicht die mit den Gabelschwänzen und den roten Kehlen. Rauchschwalben, Mehlschwalben. Es ist sinnlos, ich verwechsle sie ständig. Ab und zu setzen sie sich für ein paar Sekunden auf den Scheunenfirst. Bei den Schwalben bin ich mir nicht sicher, ob sie Glück bringen oder Unglück.
Ich gehe hinten ins Haus, steige die Treppe hoch, trete rechts in die Mädchenkammer und hole mir eins der braunen Hefte aus dem Schrank, einen Bleistift und das kleine Taschenmesser mit dem Horngriff. Keiner sieht mich. Wieder runter und raus. Ich laufe vom Scheunentor schräg über die Wiese zum Hausgarten, den grauen Lattenzaun entlang und dann zwischen den Feldern den Hügel hinauf. Ganz oben, seitlich von einem verkrüppelten Schlehdornbusch, drehe ich mich rasch um die eigene Achse, einmal und noch einmal und noch einmal. Dann setze ich mich in die Wiese.
An dieser Stelle, dicht neben dem Busch, ist der Boden fast immer trocken. Ich blicke mich um. Hier sehe ich alles. Hier ist mein Platz. Sie sagen, ich heiße Nelli. Manchmal glaube ich es, manchmal nicht. Manchmal denke ich, ich heiße Elisabeth oder Katharina. Oder Isolde, wie die junge Verkäuferin aus dem Hutgeschäft. Von Zeit zu Zeit gehe ich ihretwegen runter in die Stadt. Wenn ich vor dem Geschäft auf der Straße stehe und durchs Schaufenster blicke, schwebt drinnen der Isoldenoberkörper durch den Raum, die Regale entlang, hin und her. Der Kopf mit dem kastanienroten Aufsteckzopf schwebt mit. Von der Taille abwärts sieht man sie nicht. Ich stelle mir vor, dass sich ihre untere Hälfte irgendwo hingesetzt hat. Vielleicht ist ihr das Hin-und-her-Gehen zu anstrengend geworden. Vielleicht mag sie auch den Aufsteckzopf nicht oder die Art, in der die obere Hälfte Was kann ich für Sie tun? sagt. Solche Dinge erzähle ich aber niemandem. Sie sagen, ich bin dreizehn, es gebe da ein Dokument, genau genommen einen Zettel mit Stempel, auf dem mein Name und mein Geburtsdatum stehen. Ich habe den Zettel nie gesehen. Außerdem ist mir mein Geburtstag egal. Hier feiert niemand Geburtstag. Namenstag ja, Geburtstag nein.
Wann mein Namenstag ist, weiß keiner. Wenn ich nach ihm frage, zucken sie mit den Schultern. Wenn ich nach der Schule frage, werden sie nervös. Laurenz sagt, der Mensch muss zwar etwas lernen, aber alles zu seiner Zeit. Momentan sei es für alle das Beste, wenn ich mit der Schule noch eine Weile warte. Was für mich wirklich das Beste ist, weiß ich nicht.
Ich habe einen Plan
Ein paar Dinge weiß ich sicher: Ich bin seit einhundertsechsundvierzig Tagen da. Ich habe einen Plan. Manchmal lüge ich. Ab dem dritten oder vierten Tag habe ich in mein erstes braunes Heft Striche gemacht, auf die letzte Seite und für jeden Tag einen. Vier Striche senkrecht, einen quer, lauter Fünferpakete. "Woher weißt du, wie das geht?", hat mich Laurenz gefragt. "Keine Ahnung", habe ich gesagt, und er drauf: "Wie ein Kampfpilot." Das Heft hat er mir damals gegeben, einfach so. "Du siehst aus wie eine, die gern schreibt", hat er gesagt. Er selbst habe auch einmal so ausgesehen. Das habe dazu geführt, dass man ihn erst ins Priesterseminar gesteckt und dann zum Frontschreiber gemacht habe. Mitten im Winter sei er im Bunker gehockt und habe Tagesberichte verfasst. Um den Stift besser halten zu können, habe er sich am Daumen und Zeigefinger seines rechten Wollhandschuhs die Spitzen weggeschnitten. Das ist das Einzige, was mich an dieser Geschichte wirklich interessiert.
Alles andere – Schnee und Bajonett und Mann gegen Mann – interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe mit Antonia geredet. Sie hat versprochen, mir Handschuhe mit abklappbaren Fingerspitzen zu stricken. Sie geht in die vierte Klasse Hauptschule und strickt so schön, dass man meint, die Sachen kommen aus der Fabrik. Ich hocke auf den Fersen und schaue bloß. Die Dächer der Stadt, drei Kirchtürme, das Rathaus, der Hügel, auf dem sich die Obstbaumzeilen treffen, der Buchenwald, die Nachbarhäuser, der Graben mit dem Löschteich und den Bienenstöcken.
Im Süden, ganz weit weg, die Berge. Sonntagberg, Hochkogel, Ötscher. So sagen sie. Jeder Berg hat seinen Platz, und jeder Berg hat seinen Namen. Oben auf dem Sonntagberg steht eine Kirche, das sieht man genau. Im Moment ist der Himmel leer. Wolken und die Sonne zählen nicht. Der Mond und die Sterne würden auch nicht zählen. Flugzeuge zählen, Gänse, die im Keil fliegen, und Bussarde, wenn sie ihre Kreise ziehen. Schwalben würden zählen, aber ich sehe gerade keine. Annemarie kommt. Auf dem Kies des Weges höre ich ihre Schritte. Sie geht rasch, ein wenig unregelmäßig, dann bleibt sie stehen. Ich konzentriere mich auf jene Stelle, an der der Weg über die Kante des Hügels führt. Zuerst erscheint Annemaries Scheitel, das dunkelblonde Haar straff zur Seite gekämmt. Hinter den Ohren wird es zu Zöpfen.
Die Ohren selbst abstehend wie kleine Flügel. Der Leibkittel mit dem Blumenmuster und der Knopfleiste, die bloße Zierde ist. Sechs winzige, hellblaue Knöpfe, die nur aufgenäht sind und in Wahrheit gar nichts knöpfen. Die Schultern mit den Trageriemen der Schultasche. Sie merkt, dass ich da sitze, und hebt den Kopf. Ihr Gesicht ist dreieckig, rotfleckig und nass. Ich stehe auf. "Was hast du?", frage ich. Sie sagt nichts. "Warum weinst du?"
Alle nennen sie die Kleine, obwohl sie für ihre acht Jahre eigentlich ziemlich groß ist, die Zweitgrößte in der Klasse, behauptet sie. Sie ist die jüngste der fünf Schwestern, wahrscheinlich kommt daher die Kleine. Grete, Katharina, Antonia, Roswitha und Annemarie – die fünf Schwestern. Nach ein paar Tagen hatte ich es. Alle fünf schauen aus wie ihre Mutter. "Die Natur hat gegen den Vater entschieden", sagt Laurenz. Was braucht eine Tochter auch auszuschauen wie ihr Vater, frage ich mich. Ich sage aber nichts. "Leo schaut ein wenig aus wie sein Vater", sagt Laurenz. Davon hat der Vater allerdings nichts, denn Leo ist derzeit nicht da. Leo, der einzige Sohn. Annemarie steht da, schaut an mir vorbei, und Tränen rinnen ihr die Wangen runter. "Was hast du?", frage ich noch einmal. Es beutelt sie von oben bis unten. "Nichts", sagt sie.
Ich stelle mir vor, wie Frau Gretz, ihre Lehrerin, sie nach vorn zur Tafel holt und Sätze schreiben lässt, Die Narzissen blühen prächtig zum Beispiel oder Auch der Apfelbaum trägt schon Blüten. Ich stelle mir vor, wie Annemarie die Punkte auf den Umlauten vergisst, Blühten schreibt, mit stummem h, und sich bei Narzissen zwischen Doppel-S und scharfem S nicht entscheiden kann. Ich stelle mir vor, wie die Gretz in ihrem grauen Kostüm mit den Abzeichen auf dem Revers sich aufpflanzt, dick und rotgesichtig, den Zeigestab aus Bambus in der Hand, und es macht in dem Moment gar nichts, dass sie einen Mann mit weggeschossenem Bein zu Hause hat und eine Mutter, die den Namen ihrer Tochter nicht mehr kennt und manchmal Vogelfutter isst. Sie hebt den Bambusstab und knallt ihn mit Wucht auf den Lehrertisch.
Ich stelle mir vor, wie der Hall eine Sekunde lang in der Klasse schwebt und es in diesem Augenblick um Annemarie geschehen ist. Ich nehme sie in die Arme. "War es die Gretz?", frage ich. Sie schüttelt den Kopf. "Hat sie dich angeschrien?", frage ich. Ich stelle mir vor, wie die Gretz alle, von denen sie annehmen kann, dass sie ein wenig unsicher sind, vor die Tafel holt und Blüte, Narzisse und prächtig schreiben lässt, und wie sie herumbrüllt und sich lustig macht. Ich lege mein Gesicht an Annemaries Kopf und schnuppere an ihrem Haar. "Heute schläfst du bei mir", sage ich und stelle mir vor, wie wir beide seitlich im Bett liegen, sie vor mir, wie ich ihren Rücken spüre, der schmal ist wie der Rücken einer jungen Ziege, und wie sie am Kopf nach Wald und am Hals nach Milch riecht.
"Komm, gehen wir"
"Hat sie dich Blüte schreiben lassen?", frage ich, und, als sie erneut den Kopf schüttelt: "War es etwas anderes? Hast du etwas gesehen? Seid ihr zur Bahn gegangen? Habt ihr in die Bombentrichter geschaut?" In die Bombentrichter werfen sie manchmal Dinge, Gerümpel oder tote Tiere. "Gab es Fliegeralarm?", frage ich noch, "oder hast du jemanden getroffen, jemand Fremden?" Sie schaut durch mich hindurch und sagt nichts mehr. "Komm, gehen wir", sage ich. Wir nehmen den Weg durch den Graben. Auf ihm nähert man sich dem Hof von unten. Eine Weile sieht man ihn gar nicht mehr, und plötzlich, nach dem Löschteich, taucht er wieder auf, erst das rote Dach, dann die Fensterreihe des Obergeschoßes, dann alles. Ich mag es, wenn die Dinge auftauchen. Ich erzähle Annemarie, wie sie mir selbst damals die Gretz gezeigt hat, am Sonntag in der Kirche, wie sofort zu spüren war, dass diese Frau ganz links in der ersten Reihe in ihrem Kostüm aus festem grauem Stoff allen anderen nur Schlechtes wünscht, und wie Laurenz nach der Messe gesagt hat: "Die Gretz sieht aus wie eine Fliegerabwehrkanone." Wir gehen an den Holundersträuchern am Teich vorüber. Ein paar Meisen hüpfen in den Zweigen rum. Auf dem Weg liegt die abgestreifte Haut einer Ringelnatter. Ich steige in einem großen Schritt darüber hinweg, da sagt Annemarie plötzlich: "Die Agnes hat mich wieder reingeholt." "Welche Agnes?", frage ich, obwohl ich die Antwort kenne. Annemarie bleibt stehen.
Sie habe vor dem Haus gewartet, den Arbeitskittel über dem schwarzen Kleid, das Haar unter dem dunkelblauen Tuch mit den silbernen Streifen, so wie immer. Zuerst habe sie Annemarie gefragt, ob sie die beiden Kälber sehen wolle, die am Vortag gekommen seien, Zwillingskälber, das gebe es nicht so oft. Als sie, Annemarie, gesagt habe, nein, sie hätten selbst ein neugeborenes Kalb im Stall, habe Agnes sie an den Oberarmen gefasst. Annemarie bleibt stehen und schaut mich an. "Und dann hat sie gesagt, ich muss mit ihr reingehen", erzählt sie, "erstens bin ich ein braves Mädchen, und zweitens traut sie sich allein nicht mehr, hat sie gesagt, und dann hat sie gesagt, irgendwann bringt er sie oder sich selbst um. Wenn ich mit hineingehe, tut er das nicht gleich, hat sie gesagt." "Wer ist er?", frage ich. Ich kenne auch hier die Antwort. Sie habe sich nicht getraut zu widersprechen. Als sie mit Agnes das Haus betreten habe, sei dort ansonsten kein Mensch gewesen. Agnes habe sich ängstlich umgeschaut und sie dann rasch in die Stube geschoben, schnurstracks vor das Bild, das da über dem Esstisch hängt. Sie habe sie auf die Bank gedrängt und sich neben sie gesetzt. "Sie hat gesagt, sie will auch wieder ein Kind", sagt Annemarie, "sie hat gesagt, sie hat ein Recht darauf, und es muss ja nicht unbedingt ein Bub sein wie der Rudi." Dann habe sie gesagt, dass sie, Annemarie, ein Mädchen sei, wie es sich eine Mutter wünsche, sauber, hilfsbereit und rasch von Begriff.
Der Rudi sei auch so gewesen, vor allem rasch von Begriff, das könne man immer noch an seinen Augen sehen. Sogar seinen Namen habe er schon schreiben können, obwohl er noch nicht zur Schule gegangen sei. Sie, Annemarie, könne schon viel mehr schreiben, das wisse sie, und lesen und Heimatkunde und das Einmaleins. Der Wind fährt durch den Graben. Die jungen Blätter der Birken leuchten gelb. Wenn man nicht genau hinschaut, kann man meinen, es sind lauter Blüten. Es ist einer jener Augenblicke, in denen du erwartest, dass vor dir jemand auf den Weg tritt, ein Mann oder ein Hase zumindest. Aber es kommt keiner. Annemarie wischt sich mit dem Ärmel über die Wangen. "Ich mag die Fotografie nicht", sagt sie. "Welche Fotografie?", frage ich. "Den Rudi", sagt sie, "sein Pullover ist hässlich, und seine Hose ist so weit, und er schaut dich an wie von anderswo." Dass er einen wie von anderswo anschaut, hat schon seine Richtigkeit, denke ich, sage es aber nicht. Annemarie ist jetzt ganz weiß. Am Ende habe Agnes sie gefragt, ob sie denn wisse, was eine Adoption sei. Sie habe gesagt, ja, das wisse sie, eine Adoption sei etwas für Kinder, die keine Eltern haben, und Agnes habe gesagt, im Prinzip schon, aber manchmal sei es auch umgekehrt. (Paulus Hochgatterer, Album, 23.7.2017)