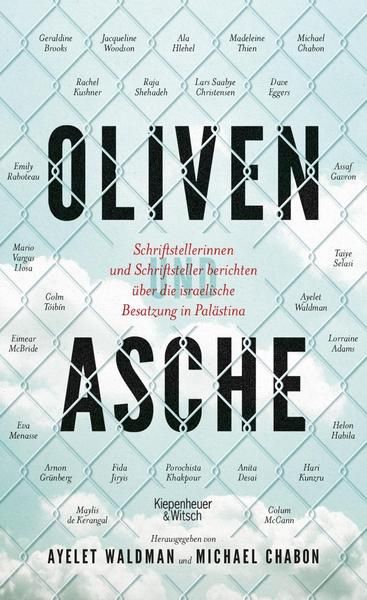In den 1970er-Jahren machte ich es mir zur Aufgabe, die politische Vorgehensweise Israels zu verteidigen, und wurde in diesem Zusammenhang in zahllose polemische Wortwechsel verwickelt. Zu jener Zeit gehörte es in Lateinamerika in gewissen Kreisen zum guten Ton, Israel heftig zu kritisieren. Und es waren nicht nur die Vertreter der extremen Linken, die dies taten, vielmehr auch Angehörige der gemäßigten Linken, zahlreiche Gruppierungen der politischen Mitte sowie rechtspopulistische Organisationen. Man warf Israel vor, eine "Schachfigur des US-amerikanischen Imperialismus" zu sein, ein Werkzeug der Vereinigten Staaten, das dazu dienen sollte, die "progressiv ausgerichteten Regierungen" im Nahen Osten zu destabilisieren und den Einfluss der Sowjetunion in der Region zu entschärfen (der insbesondere in Ägypten, aber auch andernorts sehr stark war).
Ich habe den Überblick darüber verloren, wie viele Zeitungsartikel ich in jenen Jahren geschrieben, wie viele Reden ich gehalten, wie viele Manifeste ich unterzeichnet habe, um dieser karikierten Sichtweise Israels vehement entgegenzutreten. Ich betonte immer wieder, dass Israel eine pluralistische und demokratische Gesellschaft sei und der einzige Staat im Nahen Osten, in dem es Meinungsfreiheit, Freiheit für politische Parteien und wirklich freie Wahlen gebe. Ich wies darauf hin, dass die Existenz Israels nicht etwa dem "Imperialismus" der USA geschuldet sei, sondern – vom Zionismus einmal abgesehen – dem europäischen Antisemitismus, dessen lange, blutige Geschichte im Holocaust und der Ermordung von sechs Millionen Juden durch die Nazis gipfelte.
Das Bedürfnis, zu verteidigen
Seit jener Zeit bin ich oft in Israel gewesen – einmal auch, um den Jerusalem-Preis entgegenzunehmen, auf dessen Verleihung ich bis heute sehr stolz bin. Und mein Bedürfnis, die Existenz dieses Staates zu verteidigen, und zwar eine Existenz mit sicheren Grenzen, hat nicht im Geringsten nachgelassen. Ich habe viele Freunde dort, und im Allgemeinen teilen wir die gleichen Ansichten, was den israelischen Umgang mit den Palästinensern anbelangt. Ich stehe dieser Politik äußerst kritisch gegenüber.
Und das tue ich nicht nur, weil mir eine solche Stellungnahme richtig erscheint, sondern auch, weil ich den Eindruck gewonnen habe, dass die zunehmend kolonialistischen Tendenzen der Regierungen jüngster Zeit – und hier beziehe ich mich auf die Regierungen von Ariel Sharon und Benjamin Netanjahu – der israelischen Demokratie und der Zukunft des Landes möglicherweise irreparablen Schaden zufügen. Es gibt nichts, was die politische Landschaft eines Staates dermaßen untergräbt wie das allmähliche Abrutschen in den Nationalismus oder Kolonialismus.
Eine andere Zukunft – des Friedens
Ich werde wegen meiner Ansichten zum Umgang der Israelis mit den Palästinensern natürlich häufig attackiert, insbesondere von Angehörigen der jüdischen Diaspora. Die Israelis selbst wirken im Allgemeinen etwas weniger intolerant und scheinen eine nicht ganz so engstirnige Sichtweise zu haben wie ihre Unterstützer im Ausland. Aber ich möchte betonen, dass die Kritik, die ich an der Vorgehensweise der israelischen Regierung im Zusammenhang mit den Palästinensern übe, genau so auch von Zehntausenden von Israelis in Israel selbst vorgebracht wird.
Es stimmt: Diese kritischen Stimmen sind nicht zahlreich genug, um die Parlamentswahlen zu gewinnen. Aber es gibt sie, diese Menschen, sie existieren. Manchmal mögen sie vielleicht einen demoralisierten und entmutigten Eindruck machen, aber sie hören nie auf, sich zu engagieren. Und diese Menschen – ich nenne sie die »Gerechten« – sind die beste Garantie, dass für Israel auch eine andere Zukunft möglich ist, eine Zukunft des Friedens und der Freundschaft mit seinen Nachbarn, eine Zukunft der Koexistenz und Kooperation mit den Palästinensern.
Ich bin gegen den "akademischen Boykott", mit dem man Israel droht, und werde es auch immer bleiben. Ich werde immer gegen eine kollektive Bestrafung sein, denn dabei bezahlen die "Gerechten" nur zu oft für die Vergehen der Sünder. Das gilt umso mehr in diesem Fall. Es ist vollkommen absurd, die israelischen Universitäten für die Grenzüberschreitungen ihrer Regierung zu bestrafen, denn es sind gerade die Universitäten, an denen sich oft genug die besten Initiativen für einen Widerstand gegen Netanjahus Regierung bilden und wo die konstruktivsten Ideen zu einem gerechten und vernünftigen Abkommen zwischen den Palästinensern und Israelis entwickelt werden.
Lokalaugenschein
"Das größte Problem, dem Israel sich gegenübersieht, sind die Siedlungen im Westjordanland oder besser gesagt in den besetzten Gebieten", erklärt mir Yehuda Shaul. "Ich glaube jedoch, dass es eine Lösung gibt und dass ich deren Umsetzung noch erleben werde."
Ich entgegne meinem israelischen Freund, dass man schon sehr optimistisch sein müsse, um zu glauben, dass es irgendwann in vorhersehbarer Zukunft dazu kommen könnte, dass die 377.900 Siedler in den besetzten Gebieten – die zahllose "Townships" geschaffen und die 2,9 Millionen Einwohner der palästinensischen Städte auf engstem Raum zusammengepfercht und voneinander isoliert haben – im Namen des Friedens und der gewaltlosen Koexistenz das Feld räumen könnten. Doch Yehuda, der unermüdlich daran arbeitet, jene Umstände ins Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken, die wahrzunehmen sich die Mehrzahl seiner Mitbürger weigert – nämlich die tragische Lebenssituation der Palästinenser im Westjordanland –, prophezeit mir, dass ich nach der Reise, die wir morgen zu den palästinensischen Dörfern südlich von Hebron unternehmen werden, einen Großteil meiner Skepsis verlieren werde.
Optimismus oder Immunität
Yehuda und ich waren bereits vor sechs Jahren einmal zusammen in diese Berge gefahren – ein Gebiet, das fast an der äußersten Grenze des Westjordanlands liegt. Damals gab es in dem Dorf Susiya nur noch etwa 300 Einwohner und es schien ganz so, als würde auch dieser Ort, ähnlich wie zahllose andere Dörfer in der Region, vom Erdboden verschwinden. Jetzt hat das Dorf etwa 450 Einwohner. Denn trotz aller Widrigkeiten haben sich einige Familien, die zunächst geflohen waren, dazu entschieden, zurückzukehren. Es scheint so, als verspürten sie einen ähnlichen Optimismus wie Yehuda. Oder als wären sie gegen die grausamen Erfahrungen immun geworden.
Die Schikanen, denen Susiya und die benachbarten Dörfer seit vielen Jahren ausgesetzt sind, haben bis heute nicht aufgehört. Im Gegenteil. Man zeigt mir Häuser, die vor Kurzem abgerissen wurden, Brunnenanlagen, die man mit Felsbrocken und Abfällen verschüttet hat, Bäume, die den Äxten der Siedler zum Opfer fielen, und sogar Videoaufnahmen, auf denen zu sehen ist, wie Dorfbewohner von Siedlern mit Metallstangen und Knüppeln attackiert oder von den Israelischen Verteidigungsstreitkräften, den IDF (Israeli Defense Forces), verhaftet und misshandelt werden. Im Gemeindezentrum, einem der wenigen Gebäude, die noch stehen, zeigt mir Nasser Nawaja, ein führendes Mitglied der Dorfgemeinschaft, die Abrissverfügungen. Sie hängen wie Damoklesschwerter über den Gebäuden, die den Bulldozern der Besatzer noch nicht zum Opfer gefallen sind.
Die ohnehin nicht besonders stabilen Gebäude werden unter dem Vorwand zerstört, sie seien illegal, da sie ohne Baugenehmigung errichtet worden seien. "Das ist der reine Wahnsinn", sagt Nasser. "Jedes Mal, wenn wir eine Genehmigung beantragen, um ein Haus zu bauen oder die Brunnenanlagen wieder instand zu setzen, wird sie uns verweigert. Und dann reißen sie unsere Häuser ab, weil wir sie ohne Genehmigung gebaut haben." Aus diesem Grund leben die Bauern und Schafhirten in diesem Dorf auch – wie in vielen anderen Dörfern der Region – nicht in Häusern, sondern in Zelten, in notdürftig aus Blech und Segeltuch zusammengezimmerten Verschlägen oder in den wenigen Höhlen, die die Soldaten noch nicht mit Steinen und Abfall gefüllt und somit unbewohnbar gemacht haben.
Es gibt viele "Gerechte"
Doch trotz alledem harren die Bewohner von Susiya und Jinba, den beiden Dörfern, die ich besuche, immer noch hier aus und halten der Belagerung stand. Dabei werden sie von ein paar NGOs und israelischen Gruppen unterstützt, die sich mit ihnen solidarisieren. Eine dieser Gruppen ist Breaking the Silence, der auch Yehuda angehört – mein Reisebegleiter, der mich hierher eingeladen hat. In Susiya lerne ich einen sehr freundlichen jungen Mann namens Max Schindler kennen, der als freiwilliger Helfer für ein paar Monate hierhergekommen ist, um den Kindern von Susiya Englischunterricht zu erteilen. Warum er das tut? "Damit sie sehen können, dass nicht alle Juden gleich sind."
Er ist kein Einzelfall. Es gibt viele solche "Gerechten", wie ich sie nenne, die den Palästinensern helfen, indem sie ihnen bei gerichtlichen Klagen zur Seite stehen, medizinische Hilfe leisten, alternative Energieversorgungssysteme bauen oder gegen die Misshandlungen protestieren. Unter ihnen befinden sich auch bekannte Schriftsteller wie David Grossman und Amos Oz. Sie setzen ihre Unterschrift unter zahlreiche Aufrufe, fordern ein Ende der Menschen- und Bürgerrechtsverletzungen und verlangen, dass man die Dorfbewohner in Frieden leben lässt.
Auch in dem alten Dorf Jinba wurden bereits etwa fünfzehn Häuser abgerissen, doch die solidarische Unterstützung durch Aktivisten verhinderte eine völlige Zerstörung. Jetzt hängt das Überleben Jinbas von der endgültigen Entscheidung des israelischen obersten Gerichtshofs ab. Es gibt in Jinba eine riesige, bisher verschont gebliebene Höhle, die, wie man mir berichtet, noch aus der Römerzeit stammt. Auch ihr droht jetzt die Zerstörung, weil sie sich, ähnlich wie zwölf andere Dörfer, in einem Gebiet befindet, das die israelische Regierung zur Truppenübungszone erklärt hat. Genau wie in Susiya werde ich auch in Jinba von barfüßigen mageren Kindern umringt, die jedoch ihre Lebensfreude nicht verloren zu haben scheinen. Besonders ein Mädchen mit großen spitzbübischen Augen rollt sich vor Lachen auf der Erde, als sie bemerkt, dass ich ihren arabischen Namen nicht aussprechen kann.
Mutwillige Zersplitterung
Man muss sich nur eine Karte der besetzten Gebiete näher ansehen, um zu begreifen, welcher Gedanke hinter der Verteilung der israelischen Siedlungen steht. Sie kesseln die palästinensischen Städte ein, verhindern einen Kontakt der Orte untereinander und schränken die Bewegungsfreiheit der darin lebenden Menschen massiv ein. Gleichzeitig nimmt die israelische Präsenz immer mehr zu. Und das Gebiet, aus dem sich theoretisch ein zukünftiger palästinensischer Staat zusammensetzen würde, wird immer weiter zersplittert, wodurch ein solches Unterfangen letztendlich unmöglich gemacht wird. Die Ausbreitung der Siedlungen scheint mit Absicht so gestaltet worden zu sein, dass die Zweistaatenlösung dadurch nicht mehr umsetzbar ist, obgleich die israelische Regierung doch eigentlich behauptet, diese Lösung akzeptieren zu wollen.
Warum sonst haben alle israelischen Regierungen, seien sie nun links, rechts oder in der politischen Mitte angesiedelt, die Existenz und das systematische Wachstum der illegalen Siedlungen geduldet und dulden sie auch weiterhin? Die einzige Ausnahme bildete die letzte Regierung von Ariel Sharon, die dafür gesorgt hat, dass alle israelischen Siedlungen aus dem Gazastreifen entfernt wurden. Die übrigen, von der Regierung geduldeten Siedlungen jedoch, von denen einige weltlich ausgerichtet, die meisten jedoch ultrareligiös sind, führen immer wieder zu Spannungen und Kontroversen. Und sie geben den Palästinensern das Gefühl, dass man ihnen von dem ohnehin schon sehr begrenzten Platz, der ihnen im Westjordanland gewährt wird, immer mehr raubt.
Ich behaupte nicht, die geheimsten Gedanken der israelischen politischen Elite lesen zu können. Doch es reicht schon, wenn man auf der Karte verfolgt, in welcher Weise sich die illegalen Siedlungen im Laufe der vergangenen Jahrzehnte auf dem Gebiet der Palästinenser immer weiter ausgebreitet haben. Das setzt den stillschweigenden, wenn nicht gar expliziten Willen der Regierung voraus, ein solches Handeln zu ermutigen und ihre schützende Hand darüber zu halten. Dieser Umstand führt nicht nur zu konstanten Spannungen mit den Palästinensern, sondern schafft eine politische Realität, in der es mit jedem Tag, der vergeht, schwieriger, wenn nicht bereits unmöglich wird, zwei souveräne Staaten zu gründen. Die Verlautbarungen der israelischen Behörden, eine solche Zweistaatenlösung unterstützen zu wollen, klingen daher wie leere Worte. Sie sind ein Hintergrundrauschen ohne jeden Wahrheitsgehalt.
Soldaten, Müllberge und Pfützen
Es gibt wohl kaum etwas, das für eine so dramatische und heftige Zerrüttung des friedlichen Zusammenlebens sorgt, wie die fünf Siedlungen, die mitten in Hebron entstanden sind. Etwa 800israelische Siedler im Herzen einer palästinensischen Stadt mit 200.000 Einwohnern! Um diese Siedler zu schützen, stehen ungefähr 650 israelische Soldaten in der Altstadt Wache. Darüber hinaus hat man das historische Zentrum abgeriegelt, die Straßen "entkeimt" und alle dortigen Läden, Hauseingänge und Unternehmen geschlossen. Das geht so weit, dass man sich dort heute vorkommt, als wäre man in einer Geisterstadt. Es ist ein menschenleerer, seelenloser Ort.
Ich bin schon vor elf Jahren einmal durch diese toten Straßen gelaufen. Das Einzige, was sich dort in der Zwischenzeit verändert hat, ist, dass die rassistischen Beleidigungen gegen Araber, die man früher an den Wänden sehen konnte, fast verschwunden sind. Aber es gibt immer noch dieselben Checkpoints überall, an denen Soldaten stationiert sind, und auch das Verbot für Araber, über die Hauptstraße zu laufen oder durch die anderen Straßen des Zentrums zu fahren, besteht nach wie vor. Das bedeutet, dass sie riesige Umwege in Kauf nehmen müssen, um von einem Teil der Stadt in einen anderen zu gelangen. Die vier Israelis, mit denen ich unterwegs bin, erzählen mir, das Schlimmste sei, dass niemand mehr über diese entsetzliche Situation in Hebron spricht. Niemand erwähnt noch das ungeheure Unrecht, das dort den 200.000 Einwohnern widerfährt, nur um achthundert Invasoren zu schützen.
Im Gegensatz zu den anderen Vierteln Jerusalems, die sich so makellos sauber präsentieren wie eine Stadt in der Schweiz oder Skandinavien, wimmelt es in dem östlichen Stadtteil Silwan, der sich in der Nähe der Altstadt und der al-Aqsa-Moschee befindet, von Müllbergen, übel riechenden Pfützen und aller Arten von Abfällen. Ich frage mich, ob dieser Grad an Verschmutzung kein Zufall, vielmehr Teil eines langfristig angelegten Plans ist, die 50.000 Palästinenser zu vertreiben, die hier noch leben, und sie durch Israelis zu ersetzen.
2004 begannen die ersten Siedler, das zu Silwan zählende Viertel Batan-al-Hawa zu infiltrieren, indem sie dort eines der höchsten Gebäude der Gegend errichteten. Seitdem haben sich die Siedler, die zu zwei verschiedenen Siedlerorganisationen – Elad und Ateret Cohanim – gehören, auch in andere Teile Silwans ausgebreitet. Es gibt nicht viele von ihnen: Etwa siebenhundert Siedler verteilen sich auf fünfundsiebzig Häuser. Aber sie haben einen Brückenkopf geschlagen, der zu einer weiteren Ausdehnung führen könnte.
Methoden der Aneignung
Wenn man wissen will, wo sich die Siedlungen befinden, braucht man nur nach oben zu schauen. Die israelischen Fahnen, die im lauen Morgenwind flattern, sind der beste Hinweis dafür, dass die Siedler die Gegend bereits eingekreist haben, ähnlich wie in den Bergen südlich von Hebron. Auch hier haben sie das gesamte Viertel isoliert. Laut Berichten israelischer NGOs gibt es verschiedene Methoden, mit deren Hilfe sich die Siedlergruppen die Häuser des Viertels aneignen. So haben sie zum Beispiel behauptet, im Besitz alter Dokumente zu sein, aus denen hervorgeht, dass die früheren Besitzer jüdisch gewesen seien, oder haben die Immobilien mithilfe arabischer Strohmänner gekauft. Manche sind auch vor Gericht gezogen und haben das Absentee Property Law, das israelische Gesetz zum Eigentum nicht anwesender Personen, geltend gemacht.
In extremen Fällen ist es zudem vorgekommen, dass die Siedler einfach nur darauf gewartet haben, bis die Besitzer oder Mieter umstrittener Immobilien auf Reisen gegangen sind oder nur ihr Haus verlassen haben, um sich dann gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Sind die Siedler erst einmal im Innern der Häuser, sendet ihnen die israelische Regierung Polizeischutz, denn natürlich ist dieses kleine Rinnsal von Siedlern inmitten eines Ozeans von Palästinensern einer gewissen Gefahr ausgesetzt. Doch aus dem Rinnsal werden Teiche, Seen, Meere. Die religiösen Siedler, die hier Wurzeln geschlagen haben, sind nicht in Eile: Die Ewigkeit ist auf ihrer Seite. Genau auf diese Weise haben sich israelische Enklaven im Westjordanland ausgebreitet und es in einen Schweizer Käse verwandelt. Und genau so wachsen sie auch in den arabischen Teilen Jerusalems.
Gerichtsurteile und Gefängnis
Doch dabei wird immer der Schein gewahrt, so wie auch im restlichen Staat, denn Israel versteht sich als ein sehr zivilisiertes Land. So droht etwa in Batan al-Hawa einundfünfzig palästinensischen Familien die Vertreibung aus ihren Häusern, weil die Siedler behaupten, diese hätten im 19. Jahrhundert jüdischen Eigentümern gehört.
Ich frage Zuheir Rajabi, einen Bewohner der Gegend, der für die Rechte der Palästinenser eintritt und sich bereit erklärt hat, mich bei diesem Besuch zu führen, ob er Vertrauen in das Ehrgefühl und die Neutralität der Richter hat, die solche Urteile zu fällen haben. Er starrt mich an, als sei ich noch dümmer als meine Frage. "Haben wir denn eine andere Wahl?" Und dann fährt er mit seinen Erklärungen fort. Er ist ein ziemlich nüchterner Mensch, der schon mehrere Male im Gefängnis gewesen ist. Auch seine drei Söhne, die sieben, neun und dreizehn Jahre alt sind, wurden alle schon irgendwann einmal verhaftet. Darín, seine kleine sechsjährige Tochter, steht neben ihm und klammert sich an seinem Bein fest. Sein Haus ist von zwei Siedlungen umgeben und man hat ihm bereits mehrere Angebote gemacht, es für einen höheren Preis zu verkaufen, als es wert ist. Aber er sagt, dass er niemals verkaufen wird und vorhat, in diesem Viertel zu sterben. Die Drohungen, die er von seinen Nachbarn erhält, jagen ihm keine Angst ein.
Ich frage ihn, ob die Siedler in Silwan Kinder haben. Ja, viele, antwortet er. Aber sie gehen selten vor die Tür, und wenn sie es tun, dann nur in Begleitung von Polizisten oder privaten Sicherheitskräften, die zum Schutz der Siedler engagiert wurden. Ich denke über das schreckliche, weltabgeschiedene Leben nach, das diese Kinder führen müssen, wie sie da eingesperrt in ihren gestohlenen Häusern sitzen. Und auch über das Leben ihrer Eltern und Großeltern, die fest davon überzeugt sind, dass sie, indem sie dieses Unrecht begehen, einem göttlichen Plan folgen und sich einen Platz im Paradies verdienen.
Selbstverständlich beschränkt sich religiöser Fanatismus nicht auf eine Minderheit jüdischer Siedler. Es gibt auch palästinensische Fanatiker, die sich in die Luft jagen, Bomben in Bussen oder Restaurants hochgehen lassen, die mit Raketen auf Kibbuzim im Süden des Landes zielen oder versuchen, Soldaten oder unschuldige Passanten mit dem Messer niederzustechen. Solche Verbrechen vergrößern die ohnehin schon immense Kluft, die die beiden Bevölkerungsgruppen voneinander trennt, und verschärfen den Konflikt zwischen ihnen.
Palästinenser unter Siedlern
Bei unserem Gang durch Silwan zeigt Zuheir Rajabi auf ein mehrstöckiges Gebäude, das die Siedler zur Gänze in ihre Macht gebracht haben – abgesehen von einer einzigen Wohnung, die erstaunlicherweise noch von einer siebenköpfigen palästinensischen Familie bewohnt wird. Bis jetzt haben sie es geschafft, dort wohnen zu bleiben, obwohl man ihnen sowohl das Wasser als auch den Strom abgestellt hat und sie, wie Rajabi mir erzählt, immer an die Haustür klopfen müssen, damit die Siedler sie hereinlassen.
Während unseres Gesprächs haben sich, ohne dass ich das gemerkt hätte, lauter kleine Kinder um uns geschart. Ich frage sie, ob es unter ihnen jemanden gibt, der schon mal von der Polizei verhaftet worden ist. Ein Junge mit einem frechen, vorlauten Gesichtsausdruck reckt seine Hand in die Luft: "Ich! Schon vier Mal!" Jedes Mal hat man ihn nur einen Tag und eine Nacht festgehalten. Ihm wurde vorgeworfen, er habe Polizisten mit Steinen beworfen, doch er leugnete dies beharrlich und wurde deshalb nicht vor Gericht gebracht. Der Junge heißt Shirhan mit Nachnamen und ist, wie sich herausstellt, der Sohn von Samir Shirhan, den ein Sicherheitsposten der Siedler bei einer Auseinandersetzung niederschoss und dann sterbend auf der Straße liegen ließ.
Kritik aus Liebe
Ich erzähle diese traurigen Geschichten, weil ich glaube, dass sie einen einigermaßen adäquaten Eindruck des Problems vermitteln, dem Israel nun gegenübersteht: dem Problem der Siedlungen nämlich und der sich immer weiter ausdehnenden Besetzung palästinensischer Gebiete. Israel ist durch diese Entwicklung zu einem anmaßenden Kolonialstaat geworden und hat so dem positiven, nahezu vorbildlichen Image, das man von diesem Land früher lange Zeit auf der Welt hatte, großen Schaden zugefügt.
Seit dem Tag, an dem ich Israel zum ersten Mal besuchte, empfand ich eine enorme Zuneigung für dieses Land. Ich glaube auch heute noch, dass es der einzige Ort auf der Welt ist, wo ich wirklich das Gefühl habe, ein Teil der politischen Linken zu sein. Denn unter den israelischen Linken findet man immer noch die Art von Idealismus und Freiheitsliebe, wie man sie heutzutage in weiten Teilen der Welt vergeblich bei dieser politischen Richtung sucht.
Doch es macht mich traurig, mitansehen zu müssen, wie in letzter Zeit die öffentliche Meinung dort immer intoleranter und reaktionärer geworden ist. Das erklärt auch, warum in Israel gegenwärtig die ultrareligiöseste und nationalistischste Regierung seiner Geschichte herrscht und warum die dort vertretene Politik immer undemokratischer wird. Es ist daher nicht nur eine moralische Pflicht, diese Politik anzuprangern und zu kritisieren, sondern es ist auch – wie in meinem persönlichen Fall – ein Akt, der aus Liebe geschieht.
Moralische Pflicht zum Aufdecken
Yehuda Shaul ist 33 Jahre alt, aber er sieht aus wie fünfzig. Er hat sein bisheriges Leben – und auch sein gegenwärtiges – mit einer solchen Intensität geführt, dass er die Jahre geradezu zu verbrennen scheint. Er wurde in Jerusalem als Kind einer äußerst religiösen Familie geboren, hat neun Geschwister und trug, als ich ihn vor elf Jahren kennenlernte, noch eine Kippa. Als er nach Beendigung seines Militärdienstes wieder ins Zivilleben zurückkehrte, zog er Bilanz. Da seine Mitbürger nicht zu wissen schienen, welche brutalen und verdammenswerten Taten die Armee in den besetzten Gebieten zu verantworten hatte, kam er zu dem Schluss, dass es seine moralische Pflicht sei, sie an die Öffentlichkeit zu bringen.
Zu diesem Zweck gründete Yehuda zusammen mit anderen Soldaten am 1. Juni 2004 die Organisation Breaking the Silence, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Zeugenaussagen von ehemaligen und noch diensttuenden Soldaten zu sammeln. Durch Ausstellungen und Veröffentlichungen soll die israelische und internationale Öffentlichkeit darüber in Kenntnis gesetzt werden, was wirklich in den palästinensischen Gebieten geschieht, die nach dem Krieg von 1967 besetzt wurden (eine Besatzung, die dieses Jahr ihren 50. Jahrestag erlebt). Bevor diese Texte und Videoaufnahmen verbreitet oder ausgestellt werden, durchlaufen sie die Zensur des Militärs, denn Yehuda und seine Mitarbeiter wollen keinesfalls gegen das Gesetz verstoßen. Mittlerweile haben sie über 1000 Zeugenaussagen gesammelt.
Bis vor Kurzem konnte Breaking the Silence – dank der demokratischen Schutzmechanismen, die für israelische Bürger bestehen – relativ problemlos agieren, auch wenn die Organisation von Nationalisten und religiösen Bevölkerungsgruppen heftig kritisiert wurde. Doch seit die gegenwärtige Regierung an die Macht kam – die man als die reaktionärste in der Geschichte Israels bezeichnen muss –, führt man einen überaus harten Kampf gegen die Leiter und Aktivisten der Organisation. Und zwar sowohl im israelischen Parlament, durch Stellungnahmen einiger Minister und politischer Entscheidungsträger, als auch in den Medien. Man wirft der Organisation vor, Landesverrat zu begehen, und versucht, sie zu verbieten. Auch in den sozialen Netzwerken kommt es immer wieder zu Beleidigungen und Drohungen in Richtung der Aktivisten. Yehuda Shaul lässt sich jedoch nicht einschüchtern. Er sagt, er sei Patriot und Zionist und glaube an das, was er tut.
Mit dem Stift für Gerechtigkeit
Es gibt in der schon so viele Jahrtausende währenden jüdischen Geschichte eine Tradition, die sich von jeher ununterbrochen fortführt: die Tradition der "Gerechten". Dabei handelt es sich um Männer und Frauen, die in Zeiten des Wandels oder der Krise hervortreten und sich Gehör verschaffen, die gegen die Strömung ankämpfen, sich nicht um mangelnde Popularität scheren oder um die Risiken, die sie mit ihrem Handeln eingehen. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Wahrheit ans Licht zu bringen oder für eine Sache einzutreten, die zu akzeptieren die Mehrheit sich weigert, weil sie durch Propaganda, Wut oder Unwissenheit blind geworden ist. Yehuda Shaul gehört zu diesen Gerechten, die in der heutigen Zeit leben. Und glücklicherweise ist er nicht der Einzige.
Auch die unerschütterliche Journalistin Amira Hass hat noch nicht aufgegeben. Sie ist nach Gaza gezogen, um tagtäglich die Erlebnisse der Palästinenser in ihren Berichten für Haaretz zu schildern. Ihr habe ich es zu verdanken, dass ich vor ein paar Jahren eine unvergessliche Nacht in dem fürchterlich engen, langsam der Erstickung anheimfallenden Labyrinth des Gazastreifens verbrachte, im Haus eines palästinensischen Paars, das für sein soziales Engagement bekannt ist.
Auch ihr Kollege Gideon Levy, ein unermüdlicher Autor, den ich jetzt nach langer Zeit zum ersten Mal wieder treffe, kämpft immer noch mit dem Stift in der Hand für Gerechtigkeit. Doch er ist sehr viel weniger optimistisch als damals, denn die Zahl derer, die für die Verteidigung der Vernunft, für Koexistenz und Frieden eintreten, verringert sich ständig. Und gleichzeitig gibt es einen unaufhörlichen Anstieg in den Reihen der Eiferer und Fanatiker, die eine einzige Wahrheit verkünden und ein "Großisrael" propagieren, dem niemand Geringeres als Gott selbst zur Seite steht.
Protestgruppen und Hilfsorganisationen
Aber auf dieser Reise habe ich auch noch andere Menschen kennengelernt, die ebenso mutig und unbestechlich sind wie die zuvor genannten. So wie Hanna Barag, die mir um fünf Uhr morgens an dem Qalandiya Checkpoint, an dem es vor Zäunen, Kameras und Soldaten nur so wimmelte, die Leiden der palästinensischen Arbeiter vor Augen führte, die hier stundenlang warten müssen, bevor sie passieren dürfen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Hanna stellt sich zusammen mit einer Gruppe anderer israelischer Frauen jeden Morgen vor diese Drahtzäune, um die ungerechtfertigten Verzögerungen anzuprangern und gegen die Misshandlungen zu protestieren. "Wir versuchen, diejenigen zu erreichen, die hierfür verantwortlich sind", sagt sie zu mir und zeigt dann auf die Soldaten. "Denn diese Leute hören uns nicht einmal zu." Sie ist eine winzige rechtschaffene alte Frau mit zahllosen Falten im Gesicht, aber in ihren klaren Augen leuchtet ein geradezu blendendes Licht.
Auch die Anwälte Salwa Duaibis und Gerard Horton – sie ist Palästinenserin, und er ist halb Brite, halb Australier – sehen nicht tatenlos zu. Sie sind Mitglieder einer Hilfsorganisation, die Verhandlungen in Militärgerichten überwacht, insbesondere solche, bei denen es um junge Palästinenser zwischen zwölf und siebzehn Jahren geht, die beschuldigt werden, die Sicherheit des Landes zu gefährden. Salwa und Gerard opfern tagtäglich einen Großteil ihrer Zeit, um das Unrecht zu dokumentieren, das diesen Kindern widerfährt.
Ja, es gibt in der Tat viele solcher Gerechten, doch nicht genug, um die Wahlen zu gewinnen. Vielmehr haben sie seit einigen Jahren eine Wahl nach der anderen verloren. Aber sie lassen sich von diesen Fehlschlägen nicht entmutigen. Es gibt Ärzte und Anwälte in ihren Reihen, die ihre Arbeit in halb verlassenen Dörfern verrichten, die Opfer von Misshandlungen vor Gericht verteidigen oder Journalisten und Menschenrechtsaktivisten, die Rechtsverletzungen und Verbrechen dokumentieren und sie an die Öffentlichkeit bringen. Oder es gibt solche Organisationen wie ActiveStills, in der sich junge Fotografen und Fotografinnen zusammengetan haben, um die Schrecken der Besatzung für alle Zeit festzuhalten. Da die offiziellen israelischen Pressestellen ihre Bilder nicht veröffentlichen, stellen sie diese in kleinen Galerien aus, drucken sie auf Reklametafeln in den Straßen oder veröffentlichen sie in halb legalen Publikationen im Untergrund.
Ansehen verloren, Kritiker gewonnen
Wie viele es von diesen Gerechten gibt? Tausende. Aber es sind nicht genug, um einen Umschwung der öffentlichen Meinung herbeizuführen – eine Meinung, die Israel immer kompromissloser werden lässt. Als sei es die beste Garantie für die Sicherheit des Landes, die führende Militärmacht im Nahen Osten – und anscheinend auch die sechstgrößte der Welt – zu sein. Die Gerechten wissen, dass dies ein irriger Glaube ist. Ganz im Gegenteil: Indem Israel zu einer Kolonialmacht wurde, die sich von niemandem etwas sagen lässt, die nicht verhandeln oder Zugeständnisse machen will und die allein an militärische Stärke glaubt, hat das Land das Ansehen und die Ehre verloren, die es früher einmal hatte. Und die Zahl seiner Gegner und Kritiker wächst mit jedem Tag, der vergeht.
Zwei Tage vor meiner Abreise bin ich mit zwei Männern zum Essen verabredet, die eindeutig zu den Gerechten zählen: Amos Oz und David Grossman. Sie sind nicht nur großartige Schriftsteller und alte Freunde, sondern stehen auch beide unermüdlich für den Dialog und das friedliche Zusammenleben mit den Palästinensern ein. Sie sehen sich schwierigen Zeiten gegenüber, aber sie lassen sich nicht entmutigen. Sie reißen Witze, diskutieren, erzählen Geschichten. Sie erklären mir, dass sie es sich letztendlich beide nicht vorstellen können, irgendwo anders als in Israel zu leben. Gideon Levy und Yehuda Shaul, die an diesem Abend ebenfalls zugegen sind, stimmen ihnen zu. Und dies ist das erste Mal – während all der Tage, die ich in diesem Land verbracht habe –, dass sich eine Gruppe von Israelis vollkommen einig ist. (Mario Vargas Llosa, 30.9.2017)