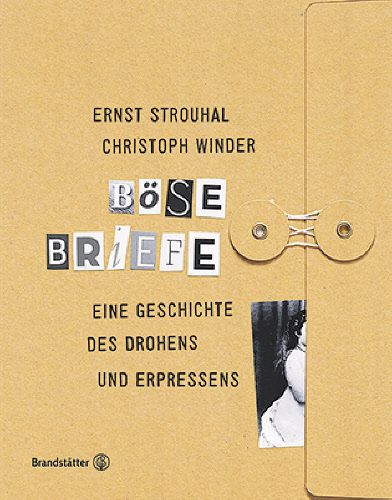Im Frühjahr 1825 erhielt eine Gruppe ausgewählter englischer Gentlemen Briefe aus Paris. Der Inhalt der Schreiben war ident und bot Anlass zur Sorge.
Harriette Wilson kündigte darin das Erscheinen ihrer Memoiren an. Wilson, Tochter eines aus der Schweiz stammenden Uhrmachers in Mayfair, war eine der berühmtesten Kurtisanen ihrer Zeit. Seit ihrem 15. Lebensjahr hatte sie freizügig gelebt und viele Beziehungen zu Angehörigen der englischen Gentry unterhalten. Als Wilson älter wurde und die Zuwendungen von ihren Unterstützern ausblieben, heiratete sie, zog nach Paris und schrieb ihre Memoiren. Sie erschienen in Fortsetzungen beim Londoner Verleger John Stockdale und waren ein Skandalerfolg. Das Buch erlebte innerhalb eines Jahres mehrere Auflagen, Raubdrucke und Übersetzungen folgten.
Vor Erscheinen informierte Wilson ihre ehemaligen Liebhaber über das Buchprojekt und machte ihnen ein Angebot: Gegen die Bezahlung von 200 Pfund würde sie auf eine – vielleicht unerfreuliche – Erwähnung ihrer Person verzichten. Man wird wohl nie erfahren, wie viele der Erpressten auf das Angebot eingegangen sind und ob das Einkommen der Autorin aus der Nichtveröffentlichung jenes aus der Veröffentlichung überstieg.
Brutalität und Höflichkeit
Der Fall Wilson ist für einen ersten Rundblick durch das kulturelle Archiv der bösen Briefe in mehrfacher Hinsicht nützlich. Ihr Schreiben ist ein klassischer Erpresserbrief, wie er in unterschiedlichen Variationen und dennoch immer ähnlich in der Kultur- und Kriminalgeschichte aufscheint. Ebenso wie die Form ist auch der Gegenstand der Erpressung uralt. "Sexual Blackmailing" gehört seit dem 17. Jahrhundert bis zum heutigen Tag zu einem der beliebtesten und ertragreichsten Felder der Erpressung.
Andererseits kann Wilson unabhängig vom Gegenstand als Autorin zu einer speziellen Tätergruppe gezählt werden: jenen Erpressern, deren Geschäft darauf basiert, dass sie die Veröffentlichung kompromittierender Nachrichten gegen Entgelt unterlassen. Man begegnet ihnen in Wien um 1920, als Imre Békessy, Herausgeber des Boulevardblattes Die Stunde, Firmen durch Androhung negativer Berichterstattung zur Schaltung von Anzeigen "überredete", ebenso wie 2015 in Marokko, als zwei französischen Journalisten vorgeworfen wurde, König Mohammed VI. für die Unterlassung der Publikation ihrer investigativen Recherchen zur Zahlung einer hohen Geldsumme genötigt zu haben. Die bezichtigten Journalisten bestritten den Erpressungsversuch; sie seien in eine Falle gelockt worden. Eine gerichtliche Klärung der Causa steht noch aus.
Obgleich die Chancen auf das Gelingen der Erpressung gering sind – weit mehr als 90 Prozent aller amtlich bekanntgewordenen Erpressungen schlagen fehl -, löst der Brief beim Empfänger zunächst Angst und Schrecken aus, unabhängig davon, ob er nun tatsächlich Schuld auf sich geladen hat oder nicht. Die unmittelbaren Reaktionen, die ein solcher Brief auszulösen vermag, sind vehement: Viele Briefe werden den Behörden in zerrissenem Zustand übergeben.
Gute Beispiele voran, Druck dahinter
Wilson arbeitet in ihrem Schreiben mit all jenen textuellen Elementen eines Erpresserbriefes, die immer wieder in stereotyper Form erscheinen. Zunächst unterbreitet die Autorin das "Angebot" einer Zahlung, und zwar gleich zu Beginn direkt und unmissverständlich, danach versucht sie, Vertrauen zu schaffen, indem Beispiele für jene genannt werden, die auf das Angebot eingegangen sind und bereits erfolgreich Schweigegeld gezahlt haben. Anschließend warnt sie vor der Öffentlichkeit ("Consult only yourself") und versucht, die eigene Position moralisch zu legitimieren ("I attack no poor men because they cannot help themselves"). Am Ende macht die Autorin Druck: "Mind, I have no time to write again." Der Brief schließt mit einer beleidigend harmlosen, indolenten Frage: "I am done up – frappé en mort. What do you think of my French?"
Mit ihrem Brief dringt Wilson, wie alle Erpresser, in die private Geschichte und Existenz einer Person vor und produziert ein Machtgefälle zwischen Autor und Leser. Dies kann durch sprachliche Brutalität, aber auch durch besondere Höflichkeit, durch geschäftsmäßige Kälte, durch Andeutungen über den Wissensstand oder, wie im Fall Wilsons, durch höhnische Zuneigung und fingiertes Verständnis hergestellt werden.
Angst, Scham und Einsamkeit
Erpresserbriefe sind Kältekammern der Briefkultur. Erzeugt werden beim Adressaten neben Angst vor allem Scham und Einsamkeit. Zugleich wecken sie, so die Briefe öffentlich werden, beim Publikum ein voyeuristisches, mehrdeutiges Interesse: Es oszilliert zwischen Schadenfreude über die Entlarvung der Doppelmoral, die diese Briefe verraten, und der unterschwelligen Angst, selbst Objekt eines solchen Angriffs zu werden. Die Angstlust vor und an den Briefen wird häufig im Witz oder in Karikaturen bearbeitet.
In der Literatur, im Film oder auf der Bühne fungiert der Brief als narrativer Brandbeschleuniger. Er schafft Ungleichgewicht in der Informationslage zwischen den Akteuren, treibt die Handlung voran und entfaltet mit geringem Aufwand einen historischen Rückraum für die Erzählung, nicht zuletzt in Kriminalgeschichten und Komödien. Das dramatische, visuell und erzählerisch dankbare Motiv des Erpresserbriefes (Öffnen des Kuverts, stilles Lesen, entsetzte Gesichter) wurde in unzähligen Thrillern variiert, von Henri-Georges Clouzots Le Corbeau (1943) bis zu den Filmen von Ethan und Joel Coen, die mit The Big Lebowski (1998), Burn After Reading (2008) und Hail, Caesar! (2016) eine besondere Vorliebe für das Thema zu erkennen geben.
Neben dem Design der Schreiben, mit dem die Verfasser beeindrucken wollen, ist die Sprache ihr zweites elementares Handwerkszeug. Wie bei der visuellen Gestaltung geht es darum, eine ominöse Identität des Senders vorzuspielen und zumeist aus dem Schutz der Anonymität heraus Macht über den Adressaten zu gewinnen. Um das Opfer willfährig zu machen, müssen Droh- und Erpresserbriefe auf maximale Wirkung hin ausgelegt sein.
Maximale Wirkung
Die sprachlichen Strategien erinnern häufig an andere Textsorten mit ausgeprägt persuasiver Funktion: an Werbung, politische Propaganda oder gar an Formen hypnotischer Induktion. Das Arsenal dieser Kommunikationsformen ist groß: direkte und indirekte Suggestionen, das Herbeiführen modifizierter Bewusstseinszustände durch das Außerkraftsetzen gängiger Bezugsrahmen und Glaubenssysteme, Konfusions-, Schock- und Überraschungstechniken, die sich auf unterschiedlichsten Ebenen implementieren lassen. So kann etwa die Wahl eines aussagekräftigen Pseudonyms – nomen est omen – eine bedrohliche oder verwirrende Atmosphäre kreieren.
In deutschen Erpresserbriefen der Gegenwart droht "Der Hexer" mit bösen magischen Kräften, "The Emperor" stellt seinen Herrschaftsanspruch klar. Während "Der Tod" wenigstens eine verständliche Botschaft verbreitet, bürden deutungsresistente Pseudonyme wie "Bananarol", "Syrianolde", "Johnny Acht" oder "Der Mastenknicker" dem Empfänger unangenehme Überlegungen auf, was im Gehirn vorgegangen sein mag, das sich dieses ausdachte. Die Assoziation zu den im Internet aktiven Postern, welche durch die Wahl ihres Nom de Guerre ("stahlhoden666") ein unbehagliches Flair verbreiten, liegt nahe. (Ernst Strouhal, Christoph Winder, 1.10.2017)