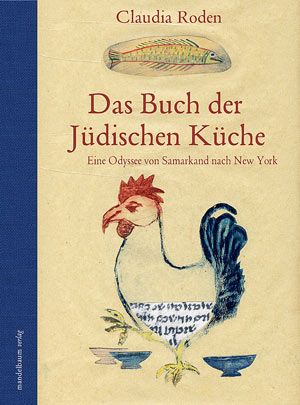Claudia Roden, die große alte Dame der Kochbuchliteratur ("Arabesque", "The Food of Spain", "Tamarind & Saffron") hat sich über 15 Jahre auf eine Spurensuche nach den Küchen der jüdischen Diaspora begeben, die sie von Samarkand über Bagdad und Aleppo bis nach New York geführt hat. Herausgekommen ist eine Enzyklopädie mit weit über 800 Rezepten, in der die Standards der aschkenasischen Küche von Kartoffellatkes bis Schmalzhering und von Lox bis Knisches und gehackter Leber festgeschrieben werden.
Erstmals aber werden in ihrem "Buch der jüdischen Küche" auch und vor allem der immense Reichtum und die Finesse der Küchen des sephardischen Judentums dokumentiert, das aufgrund seiner lange geschützten Existenz in den Städten des Osmanischen Reichs kaum Anlass gesehen hatte, seine Rezepte in Schriftform zu bringen. Roden hat die vor Aromen schillernden Küchen der Juden zwischen Marrakesch und Samarkand in Rezepte gegossen, die nicht zufällig mehr als zwei Drittel dieses massiven Werkes einnehmen. In den Einführungskapiteln zu den verschiedenen Teilen gelingt ihr nicht weniger als eine unerhört sinnliche Kulturgeschichte des jüdischen Lebens. Jetzt erscheint es endlich auch auf Deutsch.
STANDARD: Ihre Eltern kamen aus Syrien und der Türkei, Sie selbst sind in Kairo aufgewachsen, gingen in Frankreich zur Schule und leben seit mehr als 60 Jahren in London. Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen den sehr verschiedenen jüdischen Küchen dieser Orte?
Roden: Abgesehen von den Speisegeboten eigentlich kaum. Die Geschichte der sephardischen und aschkenasischen Juden ist so lange so verschieden verlaufen. Die Sephardim sind Nachfahren jener Juden, die nach der Versklavung durch Nebukadnezar in Babylon - heute Bagdad - geblieben sind, viel von den Gebräuchen, der höfischen Pracht und der hochentwickelten Kulinarik der persischen Eroberer nach Nebukadnezar übernahmen und später mit den Muslimen in alle Teile des Osmanischen Reichs gezogen sind.
Sie haben bis in die 1950er Jahre - als ein Drittel der Bevölkerung von Bagdad jüdisch war! - in weitgehender Harmonie mit ihrem jeweiligen Umfeld gelebt und dort sehr individuelle, von der jeweiligen Region befruchtete Küchenstile ausgebildet. Dadurch erkennen sich Nachfahren jüdischer Familien aus Tunis, aus Aleppo oder Marrakesch heute oft auch an den Gerichten, die sie pflegen.
STANDARD: Und die Aschkenasim in Europa?
Roden: Die haben eine ganz andere Geschichte, weil das Christentum weniger tolerant gegenüber anderen Religionen war als der Islam - zumindest bis zum Suez-Krieg zwischen Israel und Ägypten. Seit dem frühen Mittelalter lebten die Aschkenasim in Deutschland in Ghettos, im Schtetl. Dadurch war die Gemeinschaft viel enger geknüpft als im Süden.
Die Gerichte, die sie in Deutschland, später in den Städten Osteuropas kennenlernten und adaptierten, waren ziemlich homogen - und wurden als Teil des kulturellen Gepäcks überall mitgenommen. Insofern ist mit der Küche dasselbe passiert wie mit der Sprache, dem Jiddischen, mit der Art sich zu kleiden, der Spiritualität und so weiter. So finden sich in der aschkenasischen Tradition von Deutschland bis Russland sehr ähnliche Gerichte: Eingesalzenes Rindfleisch, die extensive Verwendung von Gänseschmalz und Hühnerfett, Karpfen in Aspik oder als gefilter Fisch.
STANDARD: Aber es gibt doch auch bei den Sephardim Grundmuster, die sich durch fast alle regionalen Küchenstile ziehen.
Roden: Oh, absolut. Das geht zurück auf die frühe Zeit in Bagdad, als die Sephardim viele Einflüsse von der persischen Hochkultur übernahmen.
STANDARD: Heißt dass, das ausgerechnet die jüdische und die iranische Küche bis heute Gemeinsamkeiten haben?
Roden: Gar kein Zweifel, und was für welche! Die Kombination von Fleisch und Früchten in Ragouts, die extensive Verwendung von Mandeln, Pinienkernen, Rosinen gerade auch in salzigen Gerichten - das ist unser persisches Erbe. Das übrigens oft an die Christen weitergegeben wurde: Die venezianische Tradition der Sarde in saor mit Pignoli und Rosinen etwa ist zweifellos Teil der jüdischen Tradition und in der Verlängerung ein babylonisch-persisches Erbe.
STANDARD: Eine andere wichtige Tradition ist jene der Juden im maurischen Spanien, die nach 1492 durch die Inquisition vertrieben wurden...
Roden: ...und die sich deshalb in vielen Teilen des Osmanischen Reichs ansiedelten, wo es jüdische Gemeinden gab, die in Frieden leben konnten. Spanien galt vor der Reconquista als der blühende Garten des Osmanenreichs, da konnte sich auch dank der nordafrikanischen Einflüsse eine sehr raffinierte Küche entwickeln. Durch die Vertreibung wurden die Rezepte in alle Ecken des Reiches zerstreut, nach Aleppo ebenso wie nach Istanbul, oder Thessaloniki.
Viele Rezepte der jüdischen Tradition blieben aber auch der spanischen Küche erhalten. In Galizien etwa gibt es eine lange Tradition von Nachspeisen, die mit Zitrusfrüchten und Mandeln gemacht werden - dabei wachsen dort weder Mandeln noch Zitronen. Die berühmte Tarta de Santiago aus dem katholischen Pilgerort hat zwar stets ein Kreuz als Muster - die Rezeptur aber steht eindeutig in der Tradition der jüdischen Gemeinde in Sevilla, wo diese Kombination in vielen Variationen gepflegt wurde.
STANDARD: Die Übereinstimmung mancher Rezepte ist tatsächlich verblüffend. Wie erklären Sie sich, dass dieser beispiellose Reichtum der jüdischen Küchen so lang - de facto bis zur Erstauflage Ihres Buchs vor bald 20 Jahren - ein so gut gehütetes Geheimnis war?
Roden: Na ja, was die Küche der Aschkenasim betrifft, war das ja nicht so, die ist vor allem in amerikanischen Kochbüchern gut dokumentiert worden.
STANDARD: Ich meine auch die sephardische Küche, die nicht zufällig den weitaus größten Teil des Buchs ausmacht.
Roden: Da gab es tatsächlich vergleichsweise wenige Bücher - weil die meisten Gemeinden bis in die Mitte der 1950er intakt blieben und das Erbe den Generationen weitergegeben werden konnte. Erst im Exil denkt man daran, dass so etwas bewahrt und erinnert werden muss. So ging es mir, aber auch vielen anderen. Essen ist ein wichtiger Teil der Kultur, auf einer Ebene mit Musik oder Literatur: ein essenzieller Teil der Identität.
STANDARD: Essen als Brücke zur Vergangenheit, als eine Art ideeller Heimat im Exil?
Roden: So ist es. Als ich nach dem Krieg nach London kam, waren die Viertel der Flüchtlinge aus Osteuropa voll mit Kaffeehäusern und Restaurants, in denen die Küche der verlorenen Heimat zelebriert wurde: Sauerkraut und gefilte Fisch, Apfelstrudel und Käsesahnetorte.
In Israel aber hatten es die Küchen der Sephardim anfangs sehr schwer, weil die Staatsgründer das aschkenasische Erbe als das Überlegene identifiziert hatten. Und die Sephardim glaubten das - über Jahre aßen sie offiziell nur "Steakim und Chipsim" (hebräische Verballhornung von Steak & Chips, Anm.), auch wenn ihnen ihre Mütter zu Hause ohnehin noch die traditionellen Köstlichkeiten aus den alten Heimaten, aus Tunis oder Bagdad, aus Aleppo oder Livorno vorsetzten: Das zuzugeben war in den frühen Jahren alles andere als schicklich.
STANDARD: Und heute?
Roden: Ist das komplett anders. Israel hat gelernt, sich als mediterranes Land zu verstehen. Da war die sephardische Küchentradition plötzlich sehr praktisch. Die gefeierten Restaurants in Israel kochen allesamt nach sephardischer Tradition. Dennoch: Schnitzel, ein eindeutig zentraleuropäisches Essen, ist neben Falafel und Hummus das israelische Nationalgericht.
STANDARD: Das österreichische Erbe?
Roden: Ohne Zweifel. Wobei das natürlich ein Gericht ist, das erst Ende des 19. Jahrhunderts im Zuge der Assimilation zu einem Lieblingsgericht des jüdischen Bürgertums wurde. Mit dem Effekt, dass es heute in den USA weithin als jüdisches, und nicht etwa als österreichisches Gericht wahrgenommen wird. Dasselbe gilt auch für den Apfelstrudel, der traditionell zu Neujahr verzehrt wird: In der Diaspora sind sie zu Gerichten geworden, die auch vom Umfeld als jüdisch wahrgenommen werden - zweifellos eine kleine Ironie der Geschichte. (Severin Corti, Rondo, DER STANDARD, 21.9.2012)