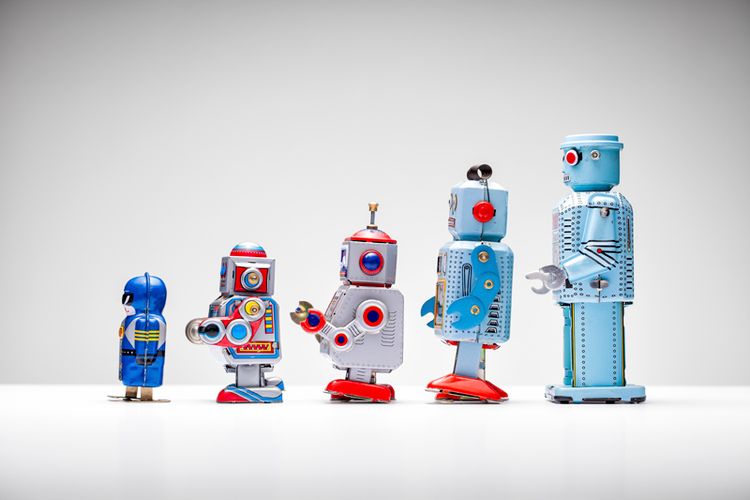
Die Familie formt nicht nur den Charakter eines Kindes, die ersten Jahre des Lebens sind auf für die spätere Gesundheit entscheidend.
Es sind Fälle, die zunächst fassungslos machen. Ein Vater schüttelt sein zwei Monate altes Kind so heftig, dass es an den Verletzungen stirbt. Ein Vater verbrüht seine quengelnde zweijährige Tochter mit einer heißen "Strafdusche" so schwer, dass sie nicht mehr gerettet werden kann. Mütter als schweigende Komplizinnen. Jugendliche, die ihre Mitschüler schikanieren, um ihren Platz in der Gesellschaft mit körperlicher und psychischer Gewalt zu erzwingen.
Gelangen solche Tragödien an die Öffentlichkeit, wird über Schuld und Strafmaß debattiert. Verantwortlich sind jene, die zu lange weggesehen haben: etwa Jugendamt, Kindergarten, Schule oder die gesamte Gesellschaft. Für die Ursachenforschung bleibt in einer emotional aufgeladenen Diskussion meist wenig Platz.
Die tragischen Fälle berichten aber auch über die zugrunde liegenden Mankos. Sie zeugen von Überforderung, Ohnmacht, Benachteiligung, Bildungsarmut, Sucht und Missbrauch, psychischen Problemen, Gefühlskälte und Gleichgültigkeit. Häufig ist es eine Kombination mehrerer Faktoren, wie Georg Sojka, Leiter des Wiener Instituts für Erziehungshilfe, betont.
Emotionale Vernachlässigung
Schätzungen zufolge gelten in Österreich zwischen fünf und zehn Prozent der Familien als mehrfach belastet, im Fachjargon auch "Multiproblemfamilien" genannt. "Die Betroffenen stammen vor allem aus sozioökonomisch benachteiligten Milieus. Emotional vernachlässigte Jugendliche sind aber auch in wohlhaben- den Schichten zu finden", relativiert Sojka.
Eines haben sie alle gemein: Kinder, die an einem Mangel emotionaler Zuwendung leiden. Die Folgen sind bekannt. Studien haben gezeigt, dass belastete Kinder ein zehnmal so hohes Risiko für Sucht, sozial auffälliges Verhalten und Depressionen entwickeln. Vorausgesetzt, es fehlt an professioneller Hilfe.
980 Eltern und Kinder werden am Institut für Erziehungshilfe von 50 Therapeutinnen und Therapeuten betreut. Das Amt für Jugend und Familie, die MA 11, stellt den Kontakt her, die Therapie ist freiwillig. "Es ist wichtig, dass sich die Therapeuten in die Familiensituationen einfühlen können.
Es geht nicht darum, intellektuell zu verstehen, sondern emotional zu erleben, wie sich die Betroffenen fühlen. Dieser Prozess hilft, dass sich die Familienmitglieder als Person angenommen erleben", erläutert Sojka den tiefenpsychologischen Ansatz.
Vertrauen als Selbstwahrnehmung
Das sei auch die notwendige Voraussetzung für eine vertrauensvolle Beziehung mit den Therapeuten. Für Eltern und Kinder sind unterschiedliche Mitarbeiter zuständig. Zu den großen Themen zählen Kommunikations- und Erziehungsfähigkeit, im Mittelpunkt steht das Aufbrechen problematischer Verhaltensmuster. "Ziel ist es, ein familiäres Klima zu schaffen, in dem sich das Kind entwickeln kann", so Sojka.
In den Worten des deutschen Sozialarbeiters Martin Feuling könnte die vereinfachte Formel lauten: "Väter und Mütter sollen zunehmend eine Vorstellung davon bekommen, was es heißt, Eltern zu sein." Sojka ergänzt: "Dient das Kind als Projektionsfläche, existiert es nicht als eigenständige Persönlichkeit. Es wird zu einem Abbild der elterlichen Wünsche und Befindlichkeiten."
Eine zentrale Rolle im therapeutischen Prozess spielt deshalb die Selbstwahrnehmung. "Wenn Eltern fähig sind, sich selbst wahrzunehmen, müssen sie das nicht über das Kind tun", resümiert der Psychotherapeut. Allerdings braucht so eine Therapie Zeit. Wöchentliche Sitzungen, zwei bis drei Jahre, in schweren Fällen auch länger.
Beeindruckende Langzeitwirkung
Je früher geholfen wird, desto besser, sind sich Experten einig. Das zeigte auch die bislang längste Präventionsfeldstudie, die 1962 vom US-Pädagogen David Weikart im Bundesstaat Michigan gemacht wurde. Er förderte 58 afroamerikanische Kinder im Alter zwischen drei und vier Jahren über einen Zeitraum von 24 Monaten, fünf Tage die Woche. In Kleingruppen wurde gespielt, gemalt und experimentiert.
Das pädagogische Angebot: Musik, Mathematik und Sprachförderung. Die Eltern wurden zusätzlich bei der Erziehung unterstützt. Für die Kontrollgruppe gab es keine Maßnahmen.
Das Ergebnis: Knapp vierzig Jahre später verdienten die damals Geförderten besser, lebten in stabileren Familienverhältnissen und wurden deutlich seltener straffällig als jene Erwachsenen, die im Kleinkindalter keine Hilfen erhalten hatten.
Früh erkennen und helfen
Auch der österreichische Bericht zur Lage der Kinder- und Jugendgesundheit verweist auf die positiven Effekte eines sozialen Frühwarn- und Hilfssystems. Konkret: ein Rückgang der Missbrauchsfälle bis zum Alter von 17 Jahren um 55 Prozent, eine Halbierung des Anteils von Kindern, die bei Pflegeeltern untergebracht werden müssen, sowie eine um 45 Prozent gesunkene Kriminalitätsrate bis zum Alter von 18 Jahren.
Dort setzt auch das Konzept der "frühen Hilfen" an, mit dem Eltern unterstützt werden sollen, ihre Erziehungsfähigkeiten zu stärken.
Es wird aber auch über Hilfestellungen bereits vor der Geburt nachgedacht. Etwa durch Weiterentwicklung des Mutter-Kind-Passes, für die derzeit eine Fachgruppe am Ludwig-Boltzmann-Institut für Health Technology Assessment evidenzbasierte Empfehlungen formuliert.
Enthalten ist dabei auch ein "Screening" für alle auf unterschiedliche Belastungsfaktoren. So sollen Familien, die Hilfe brauchen, rechtzeitig identifiziert werden. Ob, wie und wann diese Empfehlung umgesetzt wird, darüber entscheidet die Politik. "Es ist aber unwahrscheinlich, dass man die Empfehlung völlig ignoriert", so Brigitte Piso vom Boltzmann-Institut. (Günther Brandstetter, 11.12.2015)