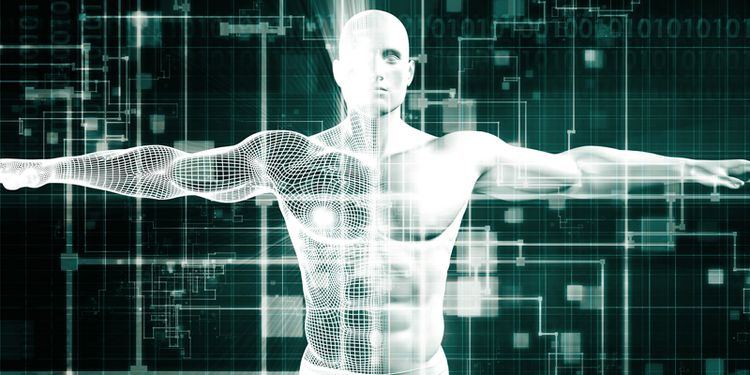Wer plötzlich entdeckt, dass ihm ein wichtiges Medikament fehlt, sollte Däne sein: Denn Bürger des skandinavischen Landes können sich auf dem Portal Sundhed.dk einloggen und dort online Rezepte für Medikamente erneuern. Auch Termine mit dem Hausarzt können über das Internet ausgemacht werden.
Außerdem kann der Patient seine Behandlungsgeschichte nachverfolgen, frische Daten einspeisen und Abrechnungen prüfen. Dänemark ist somit globaler Vorreiter im Bereich E-Health, wie die Digitalisierung von Gesundheitsdaten und Gesundheitsprozessen genannt wird. Das klingt nach mehr Komfort für Patienten, effizienteren Prozessen und somit einer Ersparnis öffentlicher Gelder.
Um die Kehrseite der Digitalisierung von Gesundheitsdaten zu sehen, muss jedoch nur die Nordsee gekreuzt werden: Denn in Großbritannien herrschte vor rund zwei Jahren helle Aufregung über die Pläne der Gesundheitsbehörde National Health Service (NHS). Sie hatte mit dem Gedanken gespielt, Patientendaten an Versicherungskonzerne zu verkaufen. Schnell hagelte es wütende Proteste, der NHS musste zurückrudern. Im Juli 2016 wurde das Programm namens Care.Data geschlossen.
Auch eine Vertrauensfrage
"Um den NHS komplett zu digitalisieren, muss die Öffentlichkeit dem medizinischen Personal dahingehend vertrauen, dass persönliche Daten sicher sind", sagte der britische Gesundheitsminister George Freeman. Die Einstellung der Datenbank ist ein herber Rückschlag für das britische Gesundheitssystem, das sich dringend reformieren wollte.
Auch hierzulande ist die Skepsis gegenüber digitalen Gesundheitsdaten groß. Mehr als 250.000 Bürger haben sich von der elektronischen Gesundheitsakte (Elga) abgemeldet, die Ärztekammer macht gegen das System mobil. Sein Ausbau passiert nur langsam. Schon 2006 wurde der Startschuss zur umfassenden Vernetzung gegeben, rund zehn Jahre später sind vorerst nur Landeskrankenhäuser in Wien, der Steiermark und erste Spitäler in Kärnten sowie Unfallkrankenhäuser angeschlossen. Labore, Hausärzte und Fachärzte folgen flächendeckend.
Bis zum online bestellbaren Rezept sei es ohnehin noch weit, da dafür erst ein E-Rezept entwickelt werden müsse. Diesen ersten Schritt erwartet Volker Schörghofer, Generaldirektorstellvertreter des Hauptverbandes der Sozialversicherungen, aber erst im vierten Quartal 2017. Momentan werde die E-Medikation getestet, also eine Datenbank, in der Ärzte und Apotheker verordnete Arzneimittel eintragen. "Der Pilotbetrieb von E-Medikation in Deutschlandsberg ist gut gestartet", sagt Schörghofer. Pro Jahr könnten 200.000 schwere Wechselwirkungen und 2,5 Millionen Doppelverordnungen vermieden werden.
Evolution statt Revolution
Susanne Herbek, bis Ende 2016 Geschäftsführerin der Elga Gmbh (Nachfolger ist Günter Rauchegger), zeigt sich in einem vergangenes Jahr geführten Gespräch mit dem STANDARD mit dem Roll-out von Elga zufrieden. "Elga kann man nicht mit einem 'Big Bang' flächendeckend einführen", sagt Herbek. Denn dazu seien die Systeme der einzelnen teilnehmenden Organisationen zu verschieden. Erste Rückmeldungen der teilnehmenden Krankenhäuser wären bislang aber durchaus positiv ausgefallen. "Schon am ersten Tag des Betriebs gab es im Unfallkrankenhaus Meidling ein Aha-Erlebnis", erzählt Herbek.
Eine Patientin, die ins UKH kam, war in den Monaten zuvor im Kaiser-Franz-Josef-Spital behandelt worden. Obwohl die beiden Krankenhäuser nur wenige Meter Luftlinie trennen, konnten sie ihre Befunde untereinander nicht austauschen. Mit Elga stellt dies kein Problem mehr dar. Auch Schörghofer denkt, dass Elga "technisch gut funktioniert". Aus den Unfallkrankenhäusern gäbe es "sehr gutes Feedback", der Nutzen zeige sich etwa, wenn ein Patient plötzlich "auf dem OP-Tisch landet" und der Chirurg dann schnell auf frühere Befunde zugreifen kann.
Gläserner Patient
Datenschützer befürchten jedoch, dass auch Unbefugte allzu leichten Zugriff auf medizinische Daten erlangen können. Bei den "Big Brother Awards", die jährlich Datenschutzverletzungen "auszeichnen", gewannen Elga und Herbek 2014 den Preis für "lebenslanges Ärgernis". Der Datenschützer Hans Zeger sprach von einer "Orwell'schen Glanzleistung der Bundesregierung" und nannte Herbek eine "Vollzeitlobbyistin in Sachen Gesundheitsüberwachung." Auch die Ärztekammer wehrte sich heftig gegen die Einführung von Elga und warnte vor dem "gläsernen Patienten".
Elga-Managerin Herbek verweist darauf, dass bestimmte Informationen entweder gelöscht oder gesperrt werden können, etwa Daten in puncto Schwangerschaftsabbrüchen oder einer HIV-Erkrankung. Bei einem sogenannten "situativen Opt-out" gelangen gar keine Daten ins System, bei einer Sperre sieht man als Patient die Infos selbst, wenn man sich in seine persönliche Elga einloggt; andere können jedoch nicht darauf zugreifen. Überhaupt gelten laut Herbek strenge Voraussetzungen für einen Abruf der Daten. "Nur wenn der Patient in Behandlung ist, dürfen die Daten eingesehen werden", erklärt Herbek. Das funktioniere durch das "Stecken der E-Card".
Datenschützer Andreas Krisch vom Forum Datenschutz stört jedoch, dass das Berechtigungssystem keine genaueren Einstellungen erlaubt. "Es wäre besser, wenn die Daten nach Fachgebieten getrennt wären", sagt Krisch, "also wenn der Augenarzt nicht Daten über frühere Geschlechtskrankheiten angezeigt bekommt." Dazu kommt die Gefahr des Datendiebstahls.
Aktive Abmeldung
Beispiele gibt es: So sollen 2012 im deutschen Klinikum Mittelbaden Zehntausende hochsensibler Patientendaten entwendet worden sein. Bei einem US-amerikanischen Betreiber mehrerer Kliniken wurden gar 4,5 Millionen Datensätze gestohlen. Der Konzern verdächtige daraufhin chinesische Hacker. In Österreich wurden hingegen 2013 Millionen Datensätze aus dem System des Österreichischen Apothekerverbandes entwendet – darunter auch jener von Bundespräsident Heinz Fischer.
Krisch, der auch Mitglied des Datenschutzrates ist, bemängelt außerdem, dass sich Nutzer aktiv vom System abmelden müssen. Besser als ein System mit Abmeldemöglichkeit – deren Prozess sich laut Krisch übrigens "zu schwierig" gestalte – zu betreiben, sei es, umgekehrt auf freiwillige Anmeldungen zu setzen.
"Wenn Bürger sehen, dass Elga ein nützliches System ist, dann nehmen die Menschen gern teil", sagt Krisch, "die Errichter des Systems haben wohl wenig Selbstbewusstsein, wenn sie zur Zwangsverpflichtung greifen." Dass sich viele nicht davor scheuen, sensible Gesundheitsdaten an große Konzerne zu übermitteln, zeigt der Boom von Fitness- und Gesundheitsapps am Smartphone. Apple und Google bieten in diesem Bereich Lösungen an, dazu kommen viele spezialisierte Anwendungen.
An der Prämie rütteln
Bei Versicherungskonzernen wie der Uniqa beschäftige man sich natürlich mit solchen "Fußfesseln", wie Peter Eichler Wearables im Scherz nennt. Eichler ist Vorstand im Bereich Personenversicherungen und sagt, die Uniqa wolle "manches, aber sicher nicht alles wissen". Man müsse zwischen medizinischen Anwendungen und Apps zur Selbstoptimierung unterscheiden, so Eichler. "Natürlich kann ich täglich mit einer App laufen gehen, ich kann mich dabei aber auch so sehr anstrengen, dass ich einen Herzinfarkt bekomme", sagt Eichler. Wichtig sei, dass ein Gesundheitsprogramm mit der Beratung durch Experten einhergehe.
Deshalb setzt die Uniqa lieber auf ein Fitnessprofil für Kunden, das durch Ärzte entwickelt wurde. Man könne damit "leicht bei der Prämie differenzieren", aber das Grundprinzip der Versicherung, also des Ausgleichs von Risiken im Pool aller Versicherten, dürfe durch den Rückgriff auf Daten nicht außer Kraft gesetzt werden.
Innovationen kommen erst
Schörghofer vom Hauptverband sieht das ähnlich. "Selbstoptimierung wird eher von Versicherten betrieben, die ohnehin auf Fitness und Ernährung achten", sagt er. Medizinische Geräte würden ein Thema werden, wenn es sich um "echte Medizinprodukte" handle. Dass Apple und Google mit ihrer Masse an Gesundheitsdaten, die sie täglich sammeln, in die Versicherungsbranche einsteigen, hält Eichler für möglich. Der Branche stehen jedenfalls in nächster Zeit große Innovationen bevor – die auch die Kunden spüren werden. (Fabian Schmid, CURE, 20.1.2017)