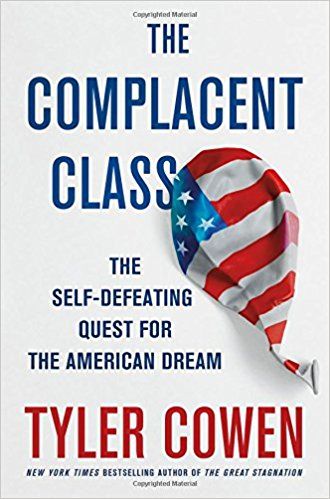Der streitbare US-Ökonom Tyler Cowen wurde 2011, nach der Publikation eines kurzen Buches ("The Great Stagnation"), weltberühmt, in dem er versucht darzulegen, warum die Ära des starken Wachstums in den Industrieländern zu Ende ist. Nun hat Cowen ein neues Werk geschrieben, in dem er seine Thesen verfeinert.
STANDARD: Sie sagen für westliche Industrieländer eine lange Phase niedrigen Wirtschaftswachstums voraus. Wo liegt das Problem?
Cowen: Es mangelt an Erfindungen, die unsere Leben revolutionieren. Die Technik hat unsere Freizeit bequemer gemacht: Man kann zu Hause bleiben, Netflix schauen, sich Musik herunterladen. Das Internet hat unsere Kommunikation verändert. Viele Menschen sind dank Facebook und Snapchat glücklicher, weil sie sich online mit Gleichgesinnten vernetzen können. Einzelgänger sind weniger einsam.
STANDARD: Aber?
Cowen: Aber abgesehen von den Veränderungen in der Kommunikationstechnologie tut sich zu wenig. Im Dienstleistungssektor steigt die Produktivität nicht an. Im Bildungssektor kaum. Im Gesundheitsbereich gibt es Fortschritte, aber nur kleine, und diese sind teuer erkauft. Die Industrie entwickelt sich in den USA gut. Aber ihr Anteil an der gesamten Wirtschaft ist heute viel zu klein, um noch einen großen Unterschied zu machen.
STANDARD: Was müsste geschehen, um das zu ändern?
Cowen: Ich fürchte, es ist für uns derzeit unmöglich, diese Dynamik zu ändern. Die Bereitschaft, Neues auszuprobieren, kreativ zu sein, ist drastisch gesunken.
STANDARD: Erklären Sie das bitte.
Cowen: In den USA hat nach den 60er- und 70er-Jahren ein Wandel eingesetzt. Diese Zeit war sehr turbulent, zum Teil gewaltsam. Die Gesellschaft hat daraufhin gesagt: Das wollen wir nie wieder zulassen. Also wurde alles darangesetzt, die Verbrechensraten im Land zu senken. Im Grunde war das eine gute Sache. Aber die Mentalität hat sich zu sehr dahingehend gewandelt, dass wir heute versuchen, alle Arten von Risiken zu vermeiden.
STANDARD: Bitte ein paar Beispiele.
Cowen: Viele Eltern lassen ihre Kinder nicht mehr draußen spielen. Es gibt in den USA inzwischen zahlreiche Schulen, an denen Kindern verboten wird, Fangen zu spielen, weil sich dabei jemand verletzen könnte. Wir greifen viel öfter zu Medikamenten, weil wir das Gefühl haben, wir dürften nicht niedergeschlagen sein. Wir wollen uns nicht erlauben, uns beunruhigt oder unwohl zu fühlen.
STANDARD: Und deshalb sinkt die Kreativität?
Cowen: Ja. Würde Vincent van Gogh heute leben, würde man ihm Antidepressiva verschreiben. Könnte er dann noch ähnlich kreativ sein, wie er war? Ich denke nicht. Hinzu kommt, dass das Internet die bestehende Tendenz dazu, Experimente zu meiden, verstärkt. Nehmen Sie zum Beispiel Musik: Die meisten Menschen können heute für wenig oder gar kein Geld die Lieder im Internet herunterladen, die ihnen gefallen. Das macht die Leute glücklich. Doch diese ständige Verfügbarkeit bedeutet, dass wir viel weniger Geld und Ressourcen aufwenden, um neue Musik zu schaffen.
STANDARD: War das früher anders?
Cowen: Ja. Früher mussten die Leute ein CD-Geschäft aufsuchen, die Regale durchstöbern. Oft hat man das Falsche gekauft, aber man war mit Neuem konfrontiert.
STANDARD: Wirkt sich die Risikoaversion auf die Wirtschaft aus?
Cowen: Ja. Die Zahl der Firmengründungen ist im Verhältnis zu schon bestehenden Unternehmen so niedrig wie nie zuvor in den USA. Weniger Start-ups schaffen den Durchbruch und werden zu Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmen. Unternehmer werden älter. Eine Folge der niedrigen Wachstumsraten ist wiederum, dass die soziale Mobilität abgenommen hat. Weniger Menschen schaffen es, aus der Armut herauszukommen. Die Entwicklungen bestärken sich auch gegenseitig.
STANDARD: Wie meinen Sie das?
Cowen: Weil Wachstum und Produktivität so niedrig sind, gibt es heute in den USA nicht mehr sehr viele Regionen, die Menschen anziehen. Die Mobilität der Amerikaner ist drastisch gesunken. Früher wollten alle in Städte, wo Automobil-, Stahl- oder Ölindustrie boomte. Heute gibt es noch das Silicon Valley, wo die großen Tech-Firmen sitzen. Aber den meisten US-Amerikanern fehlen die Fähigkeiten, um dort Fuß zu fassen. Demgegenüber gibt es in jeder Vorstadt ein Einkaufszentrum, einen Zahnarzt, eine Schule. Es gibt keinen besonderen Grund, wegzuziehen. Wenn einem das Wetter gefällt, bleibt man dort.
STANDARD: Das klingt sehr negativ.
Cowen: So ist es gar nicht gemeint. Wir leben heute im Regelfall sicherer als je zu zuvor. Der Wohlstand nimmt weiter zu, nur langsamer als früher, und nicht alle profitieren. Doch es ist mir wichtig, auf die Kehrseite hinzuweisen: Wir verabscheuen den Wandel so sehr, sind so bürokratisch geworden, dass wir uns selbst gelähmt haben. Hinzu kommen spezielle Probleme, die vor allem die USA betreffen. Die Segregation an den Wohnorten nach Einkommen und Bildungsgrad nimmt zu. Die ärmeren Schichten der Bevölkerung werden hinausgedrängt. In den wenigen verbliebenen Wachstumsregionen wollen die Wohlhabenden unter sich bleiben, weshalb nur teure Eigentumswohnungen errichtet werden.
STANDARD: Unterschätzen Sie die technische Entwicklung nicht. Was ist mit fahrerlosen Autos, was mit Veränderungen durch Roboter?
Cowen: Wenn sich diese Neuerungen durchsetzen, wird die Phase der niedrigen Produktivität zu Ende sein. Aber ich denke, das wird frühestens in 20 Jahren der Fall sein. Veränderungen brauchen heute viel mehr Zeit als in der Vergangenheit. Nehmen Sie zum Beispiel nur her, was alles nötig ist, damit sich das fahrerlose Auto durchsetzt. Die gesamte Straßenverkehrsordnung muss geändert werden, wir brauchen völlig neue Gesetze über Haftungsregelungen. Das geht nicht von heute auf morgen.
STANDARD: Was ist mit Elon Musk, dem Chef von Tesla? Ist er nicht ein Querdenker und Erfinder, der ausprobiert und Risiken eingeht?
Cowen: Ich bewundere Musk dafür. Aber er ist eine Ausnahmeerscheinung, und ich glaube, er wird mit seinem Vorhaben, das Transportwesen zu revolutionieren, scheitern.
STANDARD: Sie sagen, die Menschen wollen keine Veränderung. Aber was ist mit dem Brexit, mit dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA? Da hat eine Mehrheit für den Wandel und für das Risiko gestimmt.
Cowen: Ja. Aber Brexit und Trump sind selbst ein Produkt unserer Risikoaversion. Den Trump-Wählern und Brexit-Befürwortern wurde ja ein Märchen verkauft, dass sie mit ihrer Stimme den Wandel aufhalten und ein Stück weit in die Vergangenheit zurückgehen können, als es weniger Migranten, weniger Globalisierung gab. Das ist natürlich alles falsch, das Risiko ist erst recht gestiegen. Die Welt ist unberechenbarer geworden. (András Szigetvari, 19.4.2017)