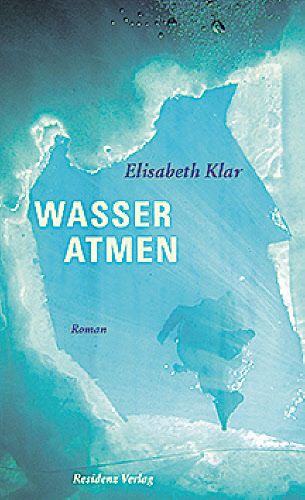Mit ihrem Erstlingswerk Wie im Wald, einem Roman in der Art eines Film noir, hat Elisabeth Klar vor zwei Jahren für Aufmerksamkeit gesorgt. Eine komplexe Familiengeschichte, im Mittelpunkt zwei Frauen, Schwestern, aber doch nicht wirklich, Freundinnen, Geliebte, mit reichlich Stoff für Irritation und schließlich einem düsteren Geheimnis, klug und überzeugend, ja erfrischend kühn erzählt.
Auch im neuen Roman stehen zwei Frauen im Mittelpunkt, doch diesmal braucht die Autorin sehr viel länger, um ihre Figuren zu entwickeln, man tut sich schwer, von ihnen auch ein begreifliches Bild zu gewinnen und überhaupt in diesem Roman einen Plot auszumachen.
Keine Geschichte zu erkennen
Was wird hier eigentlich erzählt? Eine Geschichte, wie sie der Klappentext vorgibt, ist weit und breit nicht zu erkennen: Da ist von einem einjährigen Aufenthalt in der Antarktis die Rede, von der Herausforderung, die "Polarnacht in einer Forschungsstation" zu ertragen. Das lässt vielleicht an Anna Kims Roman Anatomie einer Nacht denken, der eine Extremsituation auf Grönland schildert. Doch Klars Roman, bei aller Beunruhigung, die er erzeugt, trennt davon viel, vor allem eine nachvollziehbare Erzählung mit Spannung und Überzeugungskraft.
Für den Leser, der ständig darauf wartet, dass etwas passiert, wird das Buch irgendwann zur Geduldsprobe: Immerhin, man hat bereits zwei Drittel absolviert und ist immer noch nicht in der Antarktis gelandet. Stattdessen ist viel von Schwimmbad, Tauchgängen und Aikido, einer japanischen Kampfkunst, zu lesen.
Erika, die diese Sportart betreibt, versucht damit ihrer Angst vor der Welt zu begegnen. Sie ist Meeresbiologin, hält Vorlesungen über "Evolution versus kulturelles Lernen bei Buckelwalen", ihr Spezialgebiet ist Bioakustik, und so ist es naheliegend, dass sie bald auf Judith, eine Musikwissenschafterin, trifft, die gerade ihre Diplomarbeit schreibt. Die eine ist hinter Walgesängen her, um vor der Realsituation ihres Lebens zu flüchten, die andere scheint unfähig, eine Orientierung zu finden. Als Erika – am Schluss des Buches – in die Antarktis geht, werden Judiths Lebensängste immer offenkundiger, bis sie schließlich, am Rand einer Psychose, den Boden unter den Füßen verliert.
Überflutete Orte
Eine solche Randsituation, ein sukzessives Abdriften wird schon in Elisabeth Klars erstem Buch sehr eindringlich gezeichnet. Ist dort der Wald ein dunkler metaphorischer Ort, so dreht sich hier alles um Wasser ? ob das Begegnungen im Hallenbad sind, ein Stausee als überfluteter Ort der Erinnerung oder eben das Eismeer, das zur unüberwindlichen Distanz nicht nur der beiden Frauen, sondern zwischen dem wirklichen Leben und seiner Vorstellung erstarrt.
Das wäre allemal ein tauglicher Ansatz in dieser fragilen Psychologie, wäre vieles dabei nicht um eine Spur zu bemüht, denn die Symbolik, auf der Elisabeth Klar die Romansituation aufbaut, ist mehr als eindringlich. Am Anfang funktionieren die Bilder noch -? etwa die Vase aus Muranoglas, die einmal zu Bruch gegangen ist, gekittet wurde und durch die dennoch das Wasser rinnt. Das beschreibt noch subtil, fast zart die Verletzbarkeit des Lebens, aber wenn am Ende ein lecker Warmwasserspeicher Judiths Wohnung überflutet und sie nicht mehr die Kraft aufbringt, sich gegen das eindringende Wasser zu stellen, dann ist die Situation bereits überzeichnet.
Mit Fortdauer neigt der Roman zu einer Metaphorik, die ihn immer weiter von der realen Ebene wegrückt, der Text verliert sich zunehmend in sich wiederholenden poesieanfälligen Details und ist am Ende selbst so introvertiert, wie es die beiden Frauen Erika und Judith sind.
Symbolische Überfrachtung
Es beeindruckt zwar, wie Klar die Innenlandschaften dieser Frauen zu beschreiben vermag – sie ist wahrhaft eine Meisterin personalen Erzählens, weil sie es versteht, die Innenperspektiven ihrer Figuren so zu reflektieren, dass eine scheinbar verbindliche, allwissende Erzählung daraus entsteht?, aber die Unschärfe, mit der sie zeichnet, nimmt der Erzählung langsam ihre Kraft. Und das ist schade, denn diese Literatur hat unzweifelhaft Potenzial. In ihrem ersten Roman Wie im Wald hat Klar erstaunliche Souveränität bewiesen, diesmal zeigt sie ein fast schon routinehaftes Können, das sich letztlich selbst erschöpft. Man sucht vergeblich nach Linien, nach einem System, das sich dem Leser öffnet und nicht verkapselt. Vor allem: Dieses Buch ist viel zu lang geraten, auch deswegen erweist sich die symbolische Überfrachtung am Ende als unübersehbares Manko.
Das alles hätte sich vermeiden lassen, hätte man der Autorin geraten, ihren Text zu kürzen, gut und gerne ein Drittel hätte hier wegfallen können: Dann wären dem Leser nicht nur lähmende Wiederholungen von Bildern und Symbolen erspart geblieben, der Text wäre vor allem sachlicher und in seinem Bestreben, etwas auszusagen, konziser geworden. Und am Ende wäre vielleicht ein wirklich fesselnder Roman dabei herausgekommen. (Gerhard Zeillinger, 9.9.2017)