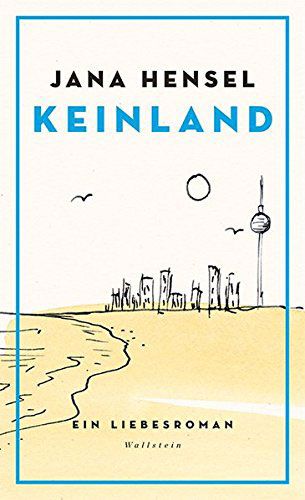
Jana Hensel, "Keinland". € 20,60 / 196 Seiten. Wallstein-Verlag, Göttingen 2017
Der Teufel steckt im Detail, heißt es. Analog dazu könnte man bei Jana Hensels Keinland sagen: Das Scheitern ist schon im Titel angelegt, in einem kleinen Wort. Land. Länder haben Grenzen, müssen sich verteidigen, führen Krieg. Und doch ist es ein Land, das die Icherzählerin mit ihrem Geliebten aufbauen möchte. "Lass uns ein neues Land gründen, habe ich zu Martin gesagt, wollte ich zu Martin sagen." Und weiter: "Endlich ein Land für dich, endlich ein Land für mich. Wie schön das klingt!"
Schön klingt es, weil die Icherzählerin Nadja und ihr Gegenüber Martin sich genau um diese Sehnsucht nach dem (Kein-)Land, nach einer Heimat drehen: Sie, eine junge Frau aus Ostdeutschland, die erlebt hat, wie nach der Wende alles verschwand, was sie kannte. Er, ein in Frankfurt aufgewachsener Jude, der in Tel Aviv lebt. Und so wie Nadja das imaginierte gemeinsame Land, so lädt er das heilige Land mit dem Versprechen von Rettung und Erlösung auf.
Das Buch beginnt, als alles schon zu Ende ist: Martin hat Nadjas Wohnung verlassen, während sie noch schlief, und fliegt von Tegel zurück nach Tel Aviv. In einem fast beschwörenden Versuch zu verstehen erinnert sich Nadja, und die Unmöglichkeit ihrer Liebe ist diesem Erzählstrom bereits eingeschrieben: "Erinnerungen hießen immer Vergeblichkeit, so war es doch." Die Sprache, die Jana Hensel dafür findet, ist eine schnörkellose, private Sprache, ein sich im Kreis drehendes Selbstgespräch. Martin taucht manchmal in der dritten, manchmal in der zweiten Person auf – dann wird das Selbstgespräch zum Zwiegespräch. Immer jedoch bleibt es Nadjas Vorstellungswelt. Selbst die Dialoge zwischen den beiden sind niemals mehr als ihre erinnerte Version dieser Gespräche. Vielleicht auch nur reine Imagination. Ihre Erinnerungen sind ungeordnet, assoziativ, springen hin und her, zwischen Zeiten und Orten, eigenen und gemeinsamen Erlebnissen. Sie sind in gewisser Weise genauso verloren, haltlos, wie es die beiden Figuren sind.
Anziehung und Abstoßung
Immer wieder erinnert sich Nadja an das erste Telefonat: Sie, die junge Berliner Journalistin, bat den um ein gutes Stück älteren Mann, Leiter einer Agentur für deutsch-israelischen Wirtschaftsberatung, um ein Interview. Ihr Auftrag: eine Reportage über Länder, in denen es Mauern gibt. Er ruft zurück, lacht sie aus, schreit sie an, sagt: "Ich liebe dieses Land, wenn es untergeht, gehe ich auch unter." Schon hier beschwört die Erzählerin eine geheimnisvolle Anziehung, eine Schicksalhaftigkeit. "Wäre da nicht er, und wäre da nicht ich, unsere Geschichte hätte nicht länger als zwei, drei, vielleicht auch vier Minuten gedauert. Keine Ewigkeit." Sie schreibt ihm eine weitere Mail: "Bevor Sie untergehen, bin ich da, Ihre Nadja."
Damit beginnt eine selbstquälerische Beziehung, ein stetiges Pendeln zwischen Anziehung und Abstoßung, das von vornherein unter dem Vorzeichen der Unmöglichkeit steht: Martin, das Kind von Holocaust-Überlebenden, die schon beim Frühstück anfingen, darüber zu reden. Und das potenzielle Täter-Kind aus den neuen Bundesländern, das die Wende nie ganz verarbeitet hat. "Du und deine Leute. Ich und meine Leute. O Gott, steht mir bei." Hier der abwesende, abweisende, unerreichbare Mann, der Nachrichten nicht beantwortet, sich hinter seinem einzigartigen Schmerz verschanzt. "Ich kann dich verstehen. Aber du verstehst mich nicht. Du weißt nicht, was in mir vorgeht." Dort die duldende, geduldige Frau, die die Herausforderung annimmt, bis zur Selbstaufgabe: "Ich werde da sein, und ich werde weg sein, wann immer du willst. Doch, Martin, ich kann das, ich schaffe das, ich schaffe alles, wenn ich nur will. Ich werde auf dich warten und dir dabei nicht zu nahe kommen. Dir nie zu nahe kommen."
Lesenswert ist das, weil Jana Hensels Text klüger ist als diese Geschlechterklischees und zeigt, um wie viel mehr es geht. Liebe ist eben kein Land, in dem man es sich einrichtet, das man einzäunt. Viel eher schon ist sie eine Bewegung. Nadja, die einmal über sich selbst sagt: "Ich hatte mir das alles schon genau vorgestellt, so wie ich mir oft Sachen vorstellte, mir ehrlich gesagt alles am liebsten einfach vorstellte. (...) Auch das Leben stelle ich mir am liebsten vor, die Liebe, den Krieg und Sex", diese Nadja geht hinaus, besucht Yad Vashem und fährt nach Polen, an den Ort, aus dem ihre Großmutter 1945 vertrieben wurde. Sie möchte Martin näherkommen, doch tatsächlich begegnet sie ihrer eigenen Geschichte. Man darf unterstellen, dass sie sich deshalb dieser Beziehung aussetzt, sieht sie doch selbst ganz klar: "Aber Martin wusste immer, so kam es mir jetzt vor, wonach ich suchte. Martins Leere und meine Leere ergaben einen Sinn, wie bei einer mathematischen Gleichung mit zwei Unbekannten."
"Ich wünsche mir nichts so sehr wie ein Kind", sagt Martin bei ihrer ersten Begegnung, und dieser Satz zieht sich wie ein Motto durch das ganze Buch. Denn es geht bei dieser Liebe nicht um Erfüllung – es geht um das, was daraus erwachsen kann. Um Erkenntnis. Im besten Fall: um Leben. (Andrea Heinz, Album, 25.9.2017)