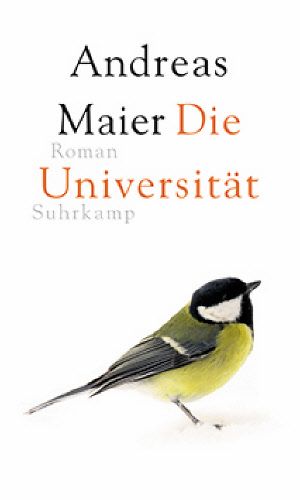Seit 2010 schreibt der deutsche Schriftsteller Andreas Maier jetzt schon an seinem Zyklus "Ortsumgehung" und ist mit seiner literarischen Arbeit nach Das Zimmer, Das Haus, Die Straße, Der Ort und Der Kreis bei Teil 6, Die Universität, gelandet, aber immer noch auf dem Weg zu "Der liebe Gott", so nämlich soll der letzte Teil seiner stark autobiografischen Reihe einmal heißen. Für Die Universität wäre es sinnvoll gewesen, Maier in Frankfurt zu treffen, denn da hat sich alles abgespielt. Das war aus terminlichen Gründen nicht möglich. So steht der Hesse aus Friedberg in der Wetterau Ende Jänner mitten in einer Münchner Bierwirtschaft. Zum Interview geht es dann aber ins Foyer seines Hotels. Da ist es ruhiger.
STANDARD: In "Die Universität" geht es am Anfang gleich in die Semesterferien. Die Universität selbst kommt erst später ins Spiel. Heißt das, dass die Universität immer auch ein gewisser Freiraum war?
Maier: Ich glaube, über einen Begriff wie "Freiraum" hätte damals keiner von uns nachgedacht. Die Universität war Teil unseres Lebens. Ich hätte niemals etwas an ihr als Verpflichtung empfunden, da ich alles frei gewählt hatte. Allerdings habe ich diese Semesterferien an den Anfang gestellt, weil sie von dem Thema Universität zuerst einmal wegführen. Am Beginn stand ich unter dem Druck, den mir der Titel vorgab, und dachte: O Gott, jetzt muss die Universitätszeit her. Aber es ist natürlich ein Buch geworden, das wieder viel mit der Buchhändlertochter zu tun hat ... Man braucht den Einstieg über diese Stelle, wo sich die Figur noch in einem 19-jährigen Romantizismus befindet. Wenn er später an der Universität ist, kann man ihn zuerst gar nicht für zurechnungsfähig halten.
STANDARD: Die Buchhändlerin kommt auch am Ende des Buches vor, das mit dem folgenden Satz endet – Vorsicht, Spoileralarm: "Es ist eiskalt hier." Ist das eine Überleitung zum nächsten Buchteil?
Maier: Der nächste Teil wird "Die Familie" heißen. Diese letzte Szene mit der Buchhändlertochter hat natürlich eine gewisse autobiografische Grundierung, und ich bin froh, dass diese Szene reingepasst hat und endlich einmal in einem Buch möglich war. Das trifft auf vieles in diesem kleinen Buch zu. Da steckt viel von dem drin, dessentwegen ich ursprünglich überhaupt begonnen habe zu schreiben. Vielleicht merkt man es an dem Schmerz, der alles wie von hinten grundiert, obgleich das, was erzählt wird, ja denkbar unspektakulär ist.
STANDARD: War ein Grund Ihres Schreibens auch der "innere Metaebenen-Kuckuck"?
Maier: Das ist ein Wort, das ich damals nicht zur Verfügung hatte. Dieser Kuckuck ist im Text eine Metapher für zwanghaftes Beobachten, Kategorisieren, er ist eine dauernd mitlaufende Stimme, ähnlich wie Sokrates' Daimonion. Übrigens schwierig, ein solches Wort beim Schreiben zu verwenden. Aber ich bin froh, wenn das Wort funktioniert.
STANDARD: Was würden Sie heute studieren, bzw. welches Studium würden Sie heute einem 18-jährigen Menschen raten?
Maier: Na ja, ich weiß ja nicht einmal, ob ich heutzutage noch die Schule ertragen könnte. Du kommst heute ja schon ganz anders aus der Schule raus als damals. Das hat erhebliche Konsequenzen für den Universitätsbetrieb. Es ist alles eine andere Welt geworden. Ich würde heute große Anstrengungen unternehmen, ein Instrument zu studieren oder an eine Gestaltungshochschule zu kommen, auf jeden Fall würde ich einen freien Studiengang wählen und kein Bachelor-Studium machen. Meine Fächer Philosophie und Germanistik könnte ich heute nicht mehr studieren.
STANDARD: Weil?
Maier: Weil sie vollkommen modularisiert sind, weil ich mich als Student nicht mehr in Themen verlieren kann, weil ich gesetzte Themen abarbeiten und Punkte sammeln muss, weil mir jede Freiheit genommen wird.
STANDARD: Wenn es nach Ihnen geht, müsste man jungen Menschen heute also raten, genau das Gegenteil von dem zu tun, was ihnen sonst geraten wird?
Maier: Wenn die Leute heute so wären wie wir damals, wäre die Maxime klar: Stürmt die Universität, besetzt sie und zwingt die Leute, von dem ganzen Bologna-Mist wieder wegzukommen. Aber mittlerweile sind alle daran gewöhnt, und dieses Widerstandspotenzial wird es nie mehr geben. Universität hieß für uns früher in erster Linie, Zeit zu haben. Heute meinen alle: Zeit haben heißt rumlungern. Aber Zeit haben heißt, sich produktiv in die Dinge zu verlaufen. Erst durch diesen Freiraum kannst du einen Bezug zu Themen, Autoren, Lebensentwürfen schaffen. Wenn alles vorgeframt ist, kommt leider immer Unlebendiges heraus.
STANDARD: Der junge Andreas in "Die Universität" liest "Doktor Faustus" von Thomas Mann. Wie ist er zu dieser Lektüre gekommen?
Maier: Auf Thomas Mann bin ich damals durch jenen Deutschlehrer gekommen, der am Ende meines letzten Buches Der Kreis als Autor eigener Gedichte hervorgetreten ist. Wir waren damals alle sehr in Abgründigkeit verstrickt. Und er hatte diese Abgründigkeit als Lehrer mit Mitte fünfzig immer noch nicht ganz abgelegt. Als er zum ersten Mal von Thomas Mann sprach, kannte ich den nur wegen der Buddenbrook-Verfilmung aus der Fernsehzeitschrift. Ich dachte, das sei todlangweilig. Allerdings war Mann nie Unterrichtsgegenstand. Jener Lehrer erwähnte nur einmal den Zauberberg und sagte, das sei ein ganz dunkles Buch, überall voller Tod. Also las ich es, das war mein Beginn mit Thomas Mann. Und es gibt einen seltsamen Zusammenhang mit dem jetzigen Buch Die Universität: Thomas Mann hatte für den Doktor Faustus viel über Beethovens Klavierstück Opus 111 von Adorno gelernt. Ich war später, was ja im Roman durchscheint, öfter bei der Witwe von Adorno. Gretel Adorno ist allerdings nicht, wie ich in dem Roman schreibe, als alte Dame im Rollstuhl ins Café Laumer gebracht worden, sondern ins Frankfurter Café Opus 111, das so hieß wegen Adorno und auch weil Thomas Mann darüber geschrieben hat.
STANDARD: Wenn "Der Kreis", wie Sie zuletzt gesagt haben, ein Künstlerroman war, ist dann "Die Universität" ein Bildungsroman?
Maier: Ich würde es eher am liebsten als ein Buch sehen, in dem ein Ich sich selbst komplett auflöst, weil es sich unter den gängigen Vorstellungen einer, ja, wie soll ich sagen, bürgerlichen Individualexistenz nicht bewahren kann. Die Zeit damals war allerdings etwas anders, als sie in dem Buch wirkt. Sie war vernebelt von vollkommener Hoffnungslosigkeit. Ich habe fast alles aus diesen Jahren vergessen, wahrscheinlich aus Selbstschutz. Die Zeit auf dieser Matratze in dem Frankfurter Zimmer kommt in dem Buch gar nicht so hart rüber, wie sie in Wirklichkeit war. Gerade das erste Jahr an der Universität war eine grauenhafte Zeit des völligen Selbstverlustes. Ich hatte nur die Musik als Ausflucht. Ich saß da am Klavier herum und habe, ohne singen zu können, die Winterreise reingehämmert. Ich war ein einziges Klischee!
STANDARD: In Ihrem Zyklus "Ortsumgehung" stehen ja alle Titel bereits fest. Eine Art Lebenswerk, das Ihnen eine Struktur zum Arbeiten schafft. Zimmer, Haus, Straße, Ort, Kreis und Universität waren ja alles ortsbezogene Begriffe. Jetzt folgen Familie, Städte, Heimat, der Teufel und der liebe Gott. Das sind keine ortsbezogenen Begriffe mehr. Was ändert sich da gerade?
Maier: Ich habe diese Titel natürlich mit einer gewissen Vorstellung gewählt. Da steht nicht: "Die Wahrheit" oder "Die Lüge". Das wären keine guten Titel. Buchtitel müssen eine gewisse Offenheit haben. Obwohl mein nächstes Buch "Die Familie" tatsächlich etwas mit dem Thema Wahrheit zu tun haben könnte. Das Buch wird vielleicht von meinem Bruder grundiert sein, von dem ich erstmals, als ich 13, 14 Jahre alt war, so etwas wie Dialektik kennengelernt habe. Ohne ihn hätte ich die Konventionen meiner eigenen Herkunft vielleicht nicht so durchschaut. Durch die Auseinandersetzung zwischen meinem Bruder und meiner Familie wurde ich schon in gewisser Weise geprägt. Mein Bruder ist ein Mensch, der unfähig ist zu lügen. Er analysiert Dinge glasklar, egal was es ihn kostet. Eine sehr ungewöhnliche Person. Er ist fünf Jahre älter als ich und lebt heute in Berlin.
STANDARD: Sie schreiben im Buch über die Schwarzer-Rollkragenpulli-Träger. Waren Sie jemand, der diesen studentischen Philosophensprech beherrscht hat?
Maier: Ich war weder in das Germanistik- noch in das Philosophiestudium besonders integriert, ich gehörte da nicht zu Zirkeln. Das kam erst beim späteren Altphilologiestudium. Als ich das mit dem Philosophensprech durchschaut hatte (ich brauchte dafür eine Weile), war ich nicht so angenehm berührt. Ich wusste lange nicht, dass es da eigentlich um Pop ging. Bei den Philosophen wäre es ein Vorteil gewesen, wenn sie mehr Ahnung von Philologie gehabt hätten.
STANDARD: "Die Ortsumgehung" kommt ja immer mehr in Richtung Gegenwart. Haben Sie Bedenken, dass Ihnen die Thematiken irgendwann zu nahe rücken?
Maier: Meine bisherigen "Ortsumgehungs"-Bücher haben immer so funktioniert, dass das, was erzählt wurde, geschützt war durch Kindheit und Jugend. Deshalb ist dieses aktuelle Buch für mich so wichtig. Immer wieder haben Leute zu mir gesagt: Siehst du, Andreas, jetzt kommt die Wahrheitsprobe, jetzt musst du anfangen, einen Erwachsenen zu machen. Damit habe ich in diesem Buch sehr gerungen. Ich hoffe, mir ist es gelungen, einen Zwanzigjährigen zu schaffen, der trotzdem noch offen für den Wahnsinn ist.
STANDARD: Dieser noch nicht ganz Erwachsene landet im Pflegedienst bei der Philosophenwitwe Gretel Adorno, die ihr Personal mit so schönen Sätzen wie "Sie sind eine Millionenhunderttausend Hornochsen" beschimpft hat. Sie beschreiben diese Pflegesituation mit großer Empathie.
Maier: Ja, mich berührt noch heute, dass sie, wie ich geschrieben habe, in unserer Umgebung sicher diejenige war, die den größten Kampf zu kämpfen hatte. Ich erinnere mich genau, wie es mir vor einem halben Jahr ging, als ich diese Seiten über sie geschrieben habe. Sie kam aus dem Nichts, das Buch war fast fertig, aber ich wusste, etwas fehlt. Nachmittags war die alte Dame plötzlich da, und ich nahm das Manuskript in eine Apfelweinwirtschaft mit und habe dort im Garten stundenlang geschrieben, bis es fertig war. Für mich war das ein magischer Moment. Alles stimmte. Vor allem habe ich noch nie einen Satz in einer Apfelweinwirtschaft geschrieben. Es gibt so Augenblicke, da weißt du, dass du nur ein Medium bist. Es war wie eine Beschwörung, sie war wieder da.
STANDARD: Sie wurden im vergangenen Jahr 50. Wie war das?
Maier: Ganz normal. Ich war mit meiner Frau mittagessen bei den Mosbachs, da gehen wir auch an unseren Hochzeitstagen immer hin, und bin mit ihr dann durch unsere vier wichtigen Apfelweinlokalitäten in Frankfurt. Das heißt, ich war in meiner alten Heimat. Gefeiert habe ich nicht.
STANDARD: Haben Sie Vorbilder, wenn es um alternde Schriftsteller geht?
Maier: Ich habe nicht das Gefühl, dass Schriftsteller besonders gut altern. Thomas Mann, der für mich der Wichtigste im deutschen Sprachraum ist, kehrte am Ende zum Felix Krull zurück und hat den mit all seiner inzwischen erworbenen emotionalen Weisheit aufgeladen. Das war eine Vermischung von Jung und Alt. Dann gab es Leute wie Max Frisch, die mit dem Alter kokettiert haben, indem sie es absichtlich inszenierten. Ab einem gewissen Alter sind wir alle bewusst auf den Tod geworfen, aber das muss sich nicht notwendigerweise in der Kunst zum Ausdruck bringen. Bei einigen Männern gibt es jedoch unübersehbar die Neigung zu einer gewissen Altersgeilheit. Aber das muss auch nicht sein, Handke etwa hat sich das im Gegensatz zu anderen erspart. Die wahren Helden des Alterns allerdings kenne ich aus meinen Frankfurter Apfelweinwirtschaften. (Mia Eidlhuber, 11.2.2018)