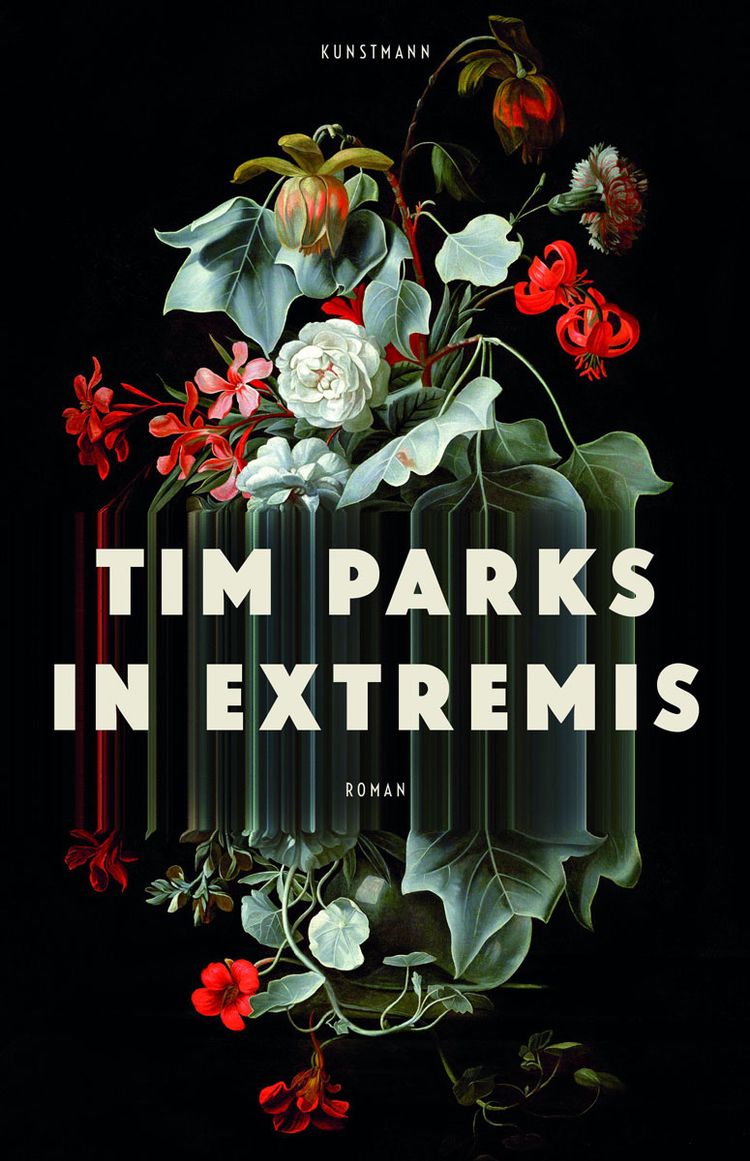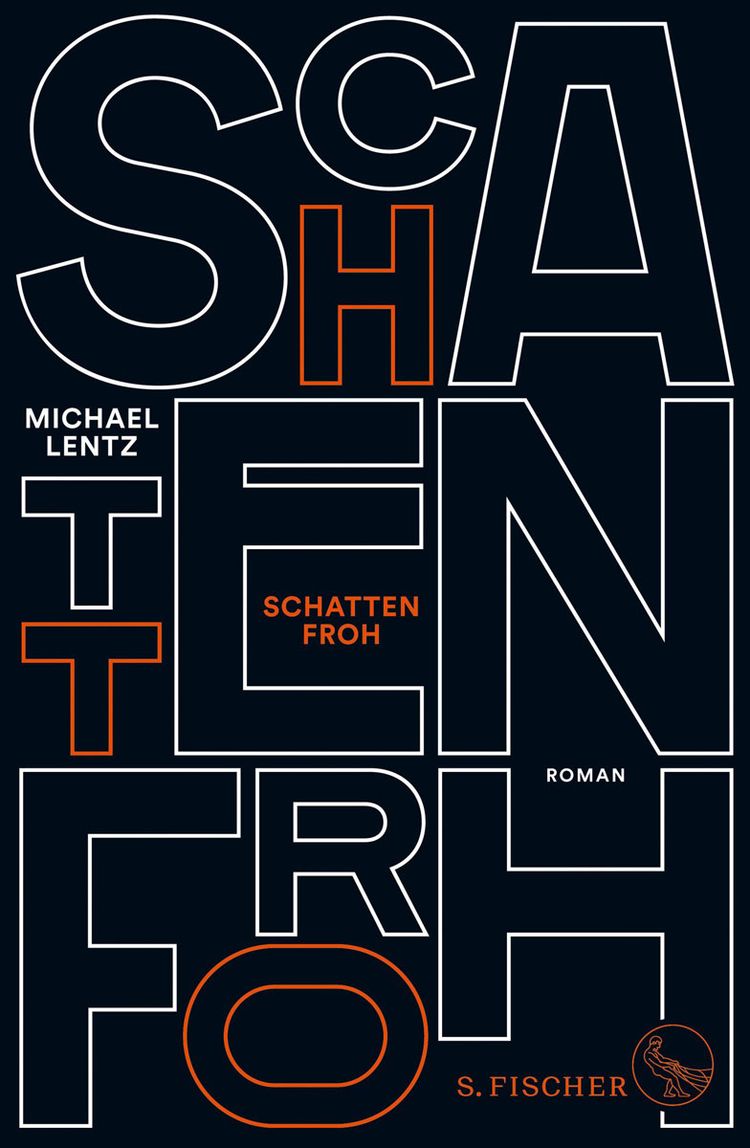Der Anblick seines Todes erschien mir viel selbstverständlicher und natürlicher als das Leben seiner letzten Jahre." Als die Tochter in den offenen Sarg blickt, scheint sich auch die Familiengeschichte in einer fast folgerichtigen Selbstverständlichkeit aufzulösen, denn mit dem toten Vater wird auch die Herkunft beerdigt, die die Erzählerin zur Außenseiterin gemacht hat: Natascha Wodins Ich ihrer Kindheit und Jugend ist ein russisches Lagerkind, das in einer Siedlung für heimatlose Ausländer aufwächst. Als es zehn ist, bringt sich die Mutter um, von nun an ist die Tochter mit ihrer kleinen Schwester dem Vater ausgeliefert, der an Integration in Deutschland nicht interessiert ist.
Fremdsein und schmerzliche Orientierungslosigkeit sind die Themen dieses großartigen Buches, eigentlich aller Bücher Natascha Wodins, die seit Jahren ihre Herkunft auf- und abarbeitet. Im Vorjahr war es ein Mutterbuch: Sie kam aus Mariupol, dafür erhielt sie den Leipziger Buchpreis. Jetzt das Vaterbuch, und es beginnt dort, wo das andere endet: im Leichenschauhaus. Dazwischen liegen mehr als dreißig Jahre, eine Entwicklungsgeschichte, die sich von der des Vaters abkoppeln möchte. Also ist es vielmehr ein Buch über sich selbst, denn hier geht es um das Heranwachsen eines Emigrantenkindes (im Schatten seines Vaters), das mit aller Vehemenz versucht, in der deutschen Nachkriegsgesellschaft anzukommen. Der Vater, der nicht nur im Herzen russisch bleibt und nie die deutsche Sprache erlernt, will sie daran hindern, sie soll nicht so sein wie die Deutschen. Die Deutschen wiederum nennen das junge Mädchen abschätzig "Russki" oder gar "Russenlusch". Klar, dass sich die Tochter umso mehr vom Vater abgrenzen muss, will sie nicht wie er ihr Leben lang eine Displaced Person bleiben.
Eigentlich lässt sich nur wenig über den Vater erzählen: An der Wolga geboren, mit 13 Vollwaise, in Mariupol heiratet er eine 20 Jahre jüngere Frau, 1943 werden beide als Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt, in die Heimat kehren sie nicht mehr zurück. Zeitlebens bleibt dieser Vater unnahbar, als gewalttätig und schweigsam erinnert ihn die Tochter. Die verachtet ihn und weiß auch nur wenig von seiner Geschichte. Als sie später in Moskau nach Verwandten sucht, ergibt auch das noch keine vollständige Erzählung der Familie.
Vielmehr ist es eine Tochtergeschichte, die die des Vaters erst zu einer dichten Erzählung macht. Sie besticht durch Offenheit und ist schonungslos aufrichtig, denn hier wird nicht der soziale Aufstieg eines Migrantenkindes mitgeteilt, sondern das Gegenteil: Mit 16 landet die Ich-Erzählerin auf der Straße, mit allen nur denkbaren schlimmen Erfahrungen.
Im späteren Leben bleibt ihr der Vater, dem sie sich bestenfalls in seiner Einsamkeit verbunden fühlt, erst recht fremd. Die Geschichte blendet wieder ein, als er bereits ein Pflegefall und es für die Tochter ohnehin zu spät ist, noch irgendetwas zu klären. Hat Hass noch Sinn, oder bleibt am Ende nur Mitgefühl? Natascha Wodin rechnet mit dem Vater nicht ab, es ist ein erstaunlich sachliches Buch, traurig nur in den Zwischentönen. Als die Tochter 1989 vor seinem offenen Sarg steht, bleibt ihr nichts anderes übrig, als der Aufforderung des russisch-orthodoxen Priesters zu folgen, sie küsst den toten Vater auf die Wange. Ein versöhnliches Zeichen ist das nicht: "Ich konnte mich nicht daran erinnern, meinen Vater jemals geküsst zu haben."
Mit einem ähnlichen Satz wird der Leser auch in Rainer Moritz' Buch konfrontiert: "Wie oft haben wir uns im Leben umarmt?" "Das war nicht üblich in unserer Familie." Die ist die typische deutsche Nachkriegsfamilie, in der alles harmonisch, distanziert, ordentlich zugeht. Genau so handelt der Autor auch das Erinnerungsthema ab, anhand der "Dinge", die die Wirklichkeit des Vaters bestimmten: des Sessels, in dem er saß, des Fernsehers gegenüber, des Ölbildes über dem Sofa, der Lesekrippe, des Aschenbechers ... Und schließlich des Bettes, in dem er starb. Man nennt das Ordnung des Lebens.
Schonungslos intim
Die gibt es natürlich auch in England, und anders als Moritz, der sich aufs Beschreiben beschränkt, rüttelt der britische Erfolgsautor Tim Parks gehörig an ihr, nämlich an jener kleinbürgerlichen Wohlgeordnetheit, die vom religiösen Background dominiert wird: Der Vater, schon vor Jahren gestorben, war Reverend, die Mutter Laienpredigerin, daran kommt man nicht vorbei, wohl ein Grund mehr, der den Sohn in Distanz zum sterbenden Familienmitglied treten lässt: "Ich hatte meine Mutter noch nicht einmal zum Abschied geküsst", muss er sich nachher sagen. Und auch später im Bestattungsinstitut, als er versäumt, den Leichnam zu "besichtigen", bleibt der Abschiedskuss aus.
Dabei beginnt der Roman schonungslos intim: Auf einem Physiotherapeutenkongress in Holland unterzieht sich Thomas Sanders gerade einer Analmassage, als ihn eine E-Mail seiner Schwester erreicht: "Mums Zustand verschlechtert sich rapide. Komm lieber sofort." Eigentlich hatte er die Hoffnung, durch die Massage seine chronischen Beckenbodenschmerzen loszuwerden. Das Gegenteil ist der Fall, und nun muss er mit der nächsten Maschine nach London und ans Sterbebett der Mutter eilen.
Bezeichnenderweise heißt der Roman In Extremis, und sein Held könnte geradewegs eine Figur von Philip Roth sein: 57, emeritierter Linguistik-Professor, die Ehe ist gerade in die Brüche gegangen, die neue Frau lebt in Spanien und ist um 30 Jahre jünger. Seit Jahren plagen diesen Thomas Sanders Unterleibsschmerzen, alle Augenblicke muss er aufs Klo rennen – genau das ist nun wieder akut geworden, und der Analmassagestab in seinem Gepäck schafft weniger Abhilfe, als er bei den Sicherheitskontrollen am Flughafen für Aufregung sorgt. Kaum in England angekommen, gerät er sofort in familiäre Verwicklungen. Eigentlich ist das Sterben der Mutter der Schlusspunkt einer jahrelangen Wegwärtsbewegung aus dem puritanischen, bigotten Familienmilieu. Und dann, als alles vorbei ist, findet sich der Sohn im Haus seiner Mutter wieder, in ihrem Schlafzimmer, auf ihrem Bett, den Analmassagestab in der Hand. Überall im Haus hängen fromme Sprüche, sogar auf dem Klo. Dass es hier weniger um die letzten Dinge als um das inszenierte "Theater der Erlösung" geht, wird spätestens auf dem Begräbnis klar, als dieses fast in einem blasphemischen Aufruhr endet. Gewiss ein einträglicher Stoff, wenngleich Tim Parks die Wiederholung liebt, die seinen Roman allzu sehr dehnt.
Dass es noch viel umfangreicher geht, zeigt uns Michael Lentz mit seinem 1000-Seiten-Roman Schattenfroh. Nach Muttersterben (2001) literarisiert er – man mag das ambitioniert oder verrückt nennen – den Tod des Vaters in einem Ungetüm von Text, der sich wie eine ins Monströse gesteigerte Kafka'sche Parabel liest. Ein Ich sitzt in einer Zelle, von einer dunklen Macht zum Schreiben angehalten. "Niemand sei ich, hat Schattenfroh gesagt", der Auftrag lautet: "Niemand erkennt sich selbst."
Erst im Kontext wird das Buch zur großen Reminiszenz an den Vater, das deutet schon der Untertitel Ein Requiem an, der sich übrigens auch auf den Heimatort des Autors bezieht: Im November 1944 wurde Düren durch einen Bombenangriff fast vollständig vernichtet, die Namen der über 3000 Toten finden sich als handschriftlicher Einschub von Seite 61 bis 136 im Buch, was schon zeigt: Dieser Text ist mehr ein Experiment als ein Roman, kein erzählerisches Ganzes, vielmehr ein Konglomerat von Geschichten, Reflexionen, Bildern. Literarische Referenzen, auch visuelle Zitate, gibt es zur Genüge, das mag zweifellos verstören: Was hat das wirklich mit dem toten Vater zu tun?
Irgendwann gegen Ende heißt es: "Das ist nicht mein Buch (...), mein Buch ist eine Person als zwei, das sind mein Vater und das bin ich." Schließlich diktiert der auch, wie eine Maschine, das Buch: jener Schattenfroh, der uns als das Böse, der Teufel, der Spiritus Rector vorgeführt wird, zugleich der omnipotente, erzkatholische Vater, der noch über den Tod hinaus Gewalt ausübt – Gewalt über diesen Text, diesen "Abrieb der Seele". Obwohl suggestiv und von unerhörter Sprachkraft, ist nichts darin wirklich fassbar. Ein Opus, das man bestaunen und vor dem man kapitulieren muss. (Gerhard Zeillinger, 1.11.2018)