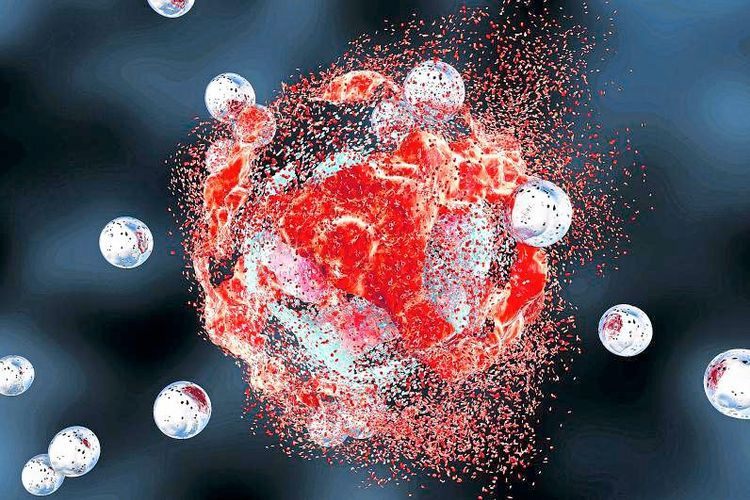
In dieser Simulation wird nachgestellt, wie spezielle Nanopartikel Tumorzellen zerstören könnten.
Die Industrie schwärmt von synthetischen Nanopartikeln – sie sind vielfältig einsetzbar und haben ein enormes Marktpotenzial. Zu den bekannteren Beispielen gehören Titandioxid-Teilchen, die in Sonnencremes vor schädlichen Ultraviolettstrahlen schützen, und Silberionen, die Bakterien abtöten sollen. Weniger bekannt sind Nanomedikamente, die Krebs in den Tumoren bekämpfen sollen, und auch die schon länger genutzten Goldnanopartikel, die etwa in Schwangerschaftstests für die roten Streifen sorgen. Neben der Medizin spielen Produkte mit Nanopartikeln auch für den Umwelt-, Werkstoff-, Kosmetik und Energiebereich eine wichtige Rolle.
Mit dem wachsenden Bedarf geht die Frage nach der Sicherheit dieser neuen Produkte für die Umwelt und unsere Gesundheit einher. Seit der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre habe man viel Wissen in Form von 30.000 Publikationen zur Nanotoxikologie zusammengetragen, sagt der Immunologe Albert Duschl von der Universität Salzburg. Trotzdem sei die Nanosicherheitsforschung weiterhin wichtig, vor allem über die Langzeitwirkung der Partikel. Inzwischen finanziere die Europäische Union die Sicherheitsforschung für Nanopartikel jährlich mit bis zu 30 Millionen Euro.
Hochrisikogruppe Kohlenstoffnanofasern
Dabei geht es unter anderem darum, die Partikel in Gruppen zusammenzufassen und für jede Gruppe neue Testverfahren zu entwickeln. Denn oft seien die gängigen Untersuchungsmethoden, die im Rahmen der europäischen Chemikalienverordnung REACH entwickelt wurden, für Nanopartikel ungeeignet. Zur Hochrisikogruppe gehören etwa lange, starre Fasern wie Kohlenstoffnanofasern, die ähnlich wie Asbestfasern Zellen mechanisch schädigen.
Kurze, steife Fasern dagegen werden von den Immunzellen unschädlich gemacht. Wichtig sei dabei auch die Entwicklung von Standards und Regulierungen für die Herstellung, damit Unternehmen Rechtssicherheit haben, so Duschl.
Nicht pauschal problematisch
Nanopartikel sind nicht pauschal problematisch oder unproblematisch, sagt der Wissenschafter. Welche Wirkung sie haben, hängt neben dem Material auch von ihrer Größe, Form, Ladung, Oberflächeneigenschaften und natürlich ihrer Konzentration ab. Wichtig zu beachten sei auch, wie sie sich in einer Materialmischung enthalten. "Zum Einsatz kommen ja meist Produkte und nicht die puren Teilchen", sagt Duschl. Er untersucht im Labor mithilfe von Lungenzellkulturen, welche Wirkung inhalierte Nanopartikel im Körper entfalten könnten. In diesen Kurzzeittests lässt sich zum Beispiel herausfinden, ob sie die Wirkungen von Allergenen verstärken und eine stärkere Immunreaktion auslösen.
"Bei Hausstaub-Allergenen und Birkenpollen reagierten die Immunzellen von Patienten teilweise tatsächlich stärker, wenn die Allergene an Gold- und andere Partikel angelagert waren", sagt Duschl. Das liege daran, dass sich die Struktur und damit die Ladungsverteilung der Naturproteine beim Anlagern oft veränderten und die Immunzellen dann möglicherweise leichter an sie herankämen. Umgekehrt sorgten andere Nanopartikel wiederum dafür, dass bestimmte Allergene weniger reizend wirkten. "Die größten Gesundheitsprobleme verursachen übrigens nicht synthetische, sondern etwa verbrennungsgenerierte Nanopartikel wie Dieselruß oder solche aus Lagerfeuern sowie aufgewirbelte Nanopartikel in der Landwirtschaft wie kristallisiertes Ammoniak", so Duschl.
Schülerprojekt
Wie sicher Nanopartikel sind und was sie zu leisten vermögen, war auch Thema auf dem "Open NanoScience Congress" an der Universität Salzburg, den Martin Himly mit Duschl organisiert hat. Hier haben auch Schüler des noch bis Ende 2019 laufenden "Nan-o-Style"-Forschungsprojekts ihre Ergebnisse vorgestellt. In dem Projekt untersuchen sie gemeinsam mit Salzburger Wissenschaftern, ob es bisher unbekannte und vor allem ungewollte Wechselwirkungen zwischen Nanopartikeln und modernen Lifestyleprodukten gibt, die Jugendliche häufig verwenden.
Was passiert zum Beispiel, wenn auf die populären Henna-Tattoos Sonnenschutzmittel mit Titandioxid-Nanopartikeln aufgetragen werden? "Um das zu untersuchen, haben wir den Farbstoff mit Titandioxid vermischt. Die Nanopartikel lagern sich zwar zusammen und bekommen andere Eigenschaften, auf Hautzellkulturen konnten wir dabei jedoch keine schädliche Wirkung feststellen", sagt Mark Geppert, der für die wissenschaftliche Betreuung der Schüler zuständig ist. Ebenso wenig hätten die Schüler problematische Wechselwirkungen zwischen den Titandioxid-Partikeln und den häufig in Kosmetika vorkommenden Parabenen beobachtet. Im Rahmen von Nan-o-Style können Schüler auch ihre Vorwissenschaftliche Arbeit anfertigen.
Entwicklungen begleiten
Mit Nanopartikel-Sicherheitsforschung beschäftigt sich auch das noch bis 2020 laufende, vom Verkehrsministerium finanzierte NanoTrust-Projekt am Institut für Technikfolgenabschätzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). "Es geht um den gesamten Produktlebenszyklus angefangen beim Ausgangsmaterial über die Konsumphase bis hin zum Abfallmanagement", sagt Projektleiter André Gazsó.
In der nunmehr fünften Phase begleite man Nanopartikel-Entwicklungen. Weitere Aufgaben seien unter anderem die Begleitforschung zur Nanotechnologie-Regulierung und die Vernetzung von Forschungseinrichtungen mit Ministerien und Regulationsbehörden.
Nicht zuletzt sei es auch unerlässlich, dass sich die Öffentlichkeit über die Nanopartikelforschung informieren kann. Die für solche Konsumentenfragen zuständige Informationsplattform Nanoinformation.at wird derzeit überarbeitet. (Veronika Szentpétery-Kessler, 2.3.2019)