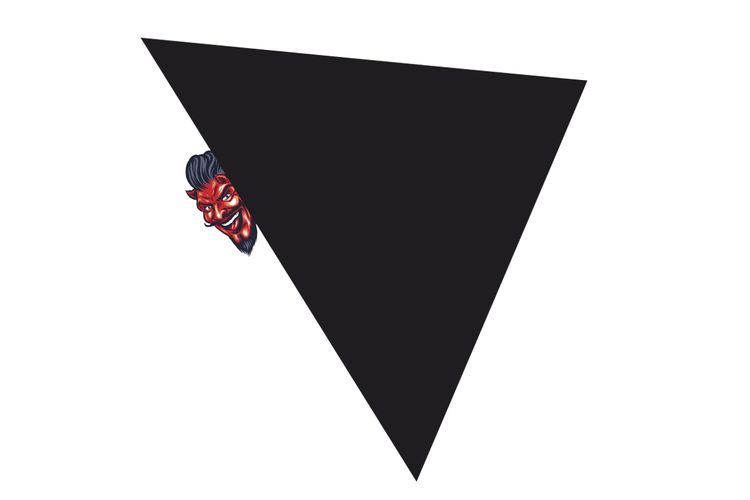
Trilemmata tauchen in der Wirtschaft und der Politik auf – und schaffen teuflische Probleme.
Es war der griechische Philosoph Epikur, der angesichts der Existenz des Bösen in der Welt erklärte, es könne keinen allmächtigen und gleichzeitig wohlwollenden Gott geben. Denn eine solche Gottheit hätte längst das Böse aus der Welt geschafft. An diesem Problem kauen die Weltreligionen seit mehr als 2000 Jahren.
Aus den 1930er-Jahren dürfte der Satz stammen, wonach niemand gleichzeitig intelligent, anständig und Nationalsozialist sein kann. Der verstorbene Kabarettist Gerhard Bronner formulierte den Aphorismus 2005 in einer Gedenkrede anlässlich der Befreiung des KZ Gunskirchen so: "Man kann intelligent und Nazi sein. Dann ist man nicht anständig. Man kann anständig und Nazi sein. Dann ist man nicht intelligent. Und man kann anständig und intelligent sein. Dann ist man kein Nazi."
Beide Male handelt es sich um ein Trilemma – einen Konflikt zwischen drei Zielen, von denen stets nur zwei erreichbar sind. Trilemmata tauchen in der Wirtschaft und der Politik auf und sorgen dort für Verwirrung und Chaos. Sie tragen verschiedene Namen – die unheilige Dreifaltigkeit oder das unmögliche Dreieck – und schaffen teuflische Probleme.
Während ein Dilemma zwar schwer zu lösen, aber leicht zu erfassen ist – völlern und schlank bleiben geht nicht, wenig arbeiten und viel verdienen auch nicht -, bleiben Trilemmata meist unbemerkt. Irgendwie, denken die Politiker, werden sich die drei Ziele schon unter einen Hut bringen lassen, man muss sich nur genügend anstrengen. Wie bei einem Tischtuch, das kleiner als der Tisch ist, oder einem zu knappen Spannleintuch ziehen sie verzweifelt an allen Ecken und brauchen lange, bis sie erkennen, dass es einfach nicht geht.
Unheilige Dreifaltigkeit
Wenn dieses Szenario ein wenig wie das Gerangel um den Brexit klingt, dann ist das kein Zufall. Stünden die Briten vor einem Dilemma, wäre es einfach. Aber sie haben mit einem Trilemma zu tun – sogar mit zwei, eines zur Globalisierung und eines zu Nordirland.
Die Politiker in London sehen lauter sinnvolle Ziele vor sich und wollen nicht wahrhaben, dass sie nicht alle erreichen können. Das werden wohl auch die EU-Politiker merken, die auf Druck der Öffentlichkeit der alljährlichen Zeitumstellung den Garaus machen wollen.
Das bekannteste Trilemma hängt mit der Wechselkurspolitik zusammen und wurde nach dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems in frühen 1970er-Jahren sichtbar. Zwei Jahrzehnte hatte die feste Bindung des Dollars an den Goldpreis für stabile Devisenkurse gesorgt, doch 1971 beendeten die USA diese Politik und gaben den Dollarkurs frei.
Deutschland, Frankreich und andere europäische Staaten wollten jedoch ihre Währungen untereinander stabil halten. Sie versuchten es zunächst mit der sogenannten Währungsschlange, ab 1979 mit dem Europäischen Wechselkurssystem (EWS). Doch diese Bindungen hielten nicht, regelmäßig kam es zu Auf- und Abwertungen und neuen Währungskrisen.
Die Erklärung für dieses Scheitern hatten Jahre zuvor die beiden Ökonomen Robert Mundell und Marcus Fleming geliefert. Ein Land könne nicht gleichzeitig geldpolitische Autonomie, freien Kapitalverkehr und feste Wechselkurse haben, behaupteten sie. Mit dem Abbau der strengen Kapitalkontrollen seit den 1960er-Jahren mussten sich die Staaten nun zwischen flexiblen Wechselkursen und einer strikt koordinierten Geldpolitik entscheiden.
Qualen in der Eurozone
Österreich entschied sich für die zweite Option – und konnte die jahrzehntelange Bindung des Schillings an die D-Mark nur deshalb bewahren, weil die Nationalbank ab 1973 blind der Geldpolitik der Deutschen Bundesbank folgte. Frankreich und Italien waren dazu zunächst nicht bereit, weshalb das Wechselkurssystem so krisenanfällig war. Erst ab 1984 setzte ein Umdenken ein, das letztendlich zur Währungsunion führte.
Doch heute noch quält das Mundell-Fleming-Trilemma die Eurozone: Die Mitgliedstaaten haben eine autonome Geldpolitik aufgegeben und akzeptieren alle die gleichen Zinsen der Europäischen Zentralbank, obwohl etwa derzeit die Länder im Norden höhere Zinsen und die im Süden niedrigere benötigen würden. Aber die Alternative wären schwankende Wechselkurse oder Kapitalkontrollen.
Der US-amerikanische Ökonom Dani Rodrik definierte 2011 in seinem Buch Das Globalisierungsparadox ein weiteres Trilemma: Man könne nicht gleichzeitig Demokratie, nationale Souveränität und intensive Globalisierung verfolgen. Rodrik bezog sich vor allem auf Schwellenländer wie Argentinien, seine Analyse trifft noch mehr auf die EU zu.
Eine stärkere wirtschaftliche und politische Integration – sprich europäische Globalisierung – verlangt, dass Entscheidungen ohne direkte Beteiligung der nationalen demokratischen Prozesse fallen, weil sonst jedes Land das gemeinsame Handeln stoppen könnte.
Wer dieses demokratische Defizit überwinden will, muss für die Bildung eines europäischen Bundesstaates eintreten, in dem die Nationalstaaten aufgehen. Wer das nicht will, muss Integration und Globalisierung einschränken. Die meisten Europäer wollen auf nichts verzichten, weshalb die EU-Politik leicht zu einem Gezerre zwischen diesen Zielen verkommt.
Brexit-Drama
Das erklärt auch das Brexit-Drama: In einer demokratischen Abstimmung haben die Briten für eine Stärkung der nationalen Souveränität gestimmt, wollen aber nun auf die Früchte der wirtschaftlichen Integration nicht verzichten.
Ein noch krasseres Trilemma stellt die Nordirland-Frage dar: Die Regierung von Theresa May will einen Austritt aus der EU ohne Bildung einer neuerlichen Zollunion, damit Großbritannien eigene Handelsverträge schließen kann; eine weiterhin offene Grenze zwischen der Provinz Nordirland und dem EU-Staat Irland, denn darauf beruht der Friedensprozess; und schließlich soll es keine Binnengrenze zwischen Nordirland und Britannien geben, was die Einheit des Vereinigten Königreichs gefährden würde.
Doch die drei Ziele sind unvereinbar: Bei einem Austritt aus der Zollunion muss irgendwo eine Grenze entstehen. Das wollte May die längste Zeit nicht wahrhaben, und es erklärt auch, warum im britischen Unterhaus seit Wochen für keine einzige Option eine Mehrheit zustande kommt. Schuld ist das Trilemma.
Ohne Zeitumstellung geht es nicht
Ein ähnliches Schicksal droht dem Beschluss der EU-Kommission und des Europaparlaments, die Zeitumstellung zu beenden. Keine Frage: Zweimal im Jahr an den Uhren zu drehen ist unangenehm und unpopulär. Aber was wäre die Alternative?
Im Osten der mitteleuropäischen Zeitzone – in Deutschland und Österreich, noch mehr aber in Ungarn, der Slowakei und Polen – will man auf die Stunde extra Tageslicht im Sommer nicht verzichten und wünscht sich die ständige Sommerzeit.
Im Westen aber – in Frankreich, den Beneluxstaaten und Spanien – wäre die Folge, dass die Sonne im Winter erst kurz vor zehn Uhr aufgeht. Dass sich alle Staaten der MEZ gemeinsam für ständige Sommer- oder Winterzeit entscheiden, ist daher sehr unwahrscheinlich.
Geografen haben eine Lösung: eine Zeitzonengrenze entlang des Rheins, mitten durch eines der am dichtesten besiedelten Regionen der Welt. Doch dies wäre wirtschaftlich und politisch eine Katastrophe.
Kurz gesagt: Die drei Ziele – der Verzicht auf eine Zeitumstellung, eine einheitliche Zeitzone in Kerneuropa und eine, die für alle Staaten alltagstauglich ist – sind nicht kompatibel. Ein Brexit-artiges Tauziehen ist in den kommenden Jahren zu erwarten. Am Ende dürfte wohl alles so bleiben, wie es ist.
Denn um ein Trilemma zu lösen, muss man Abstriche machen und die beste von drei imperfekten Optionen wählen. Bei der Zeit wäre das, wenn die Zeitumstellung bleibt, beim Brexit wäre das eine Zollunion. Doch davon muss man die Kritiker und Gegner erst einmal überzeugen.
Das ist genauso mühsam wie der Versuch, eine Matratze mit einem zu kleinen Leintuch zu überziehen. (Eric Frey, 7.4.2019)